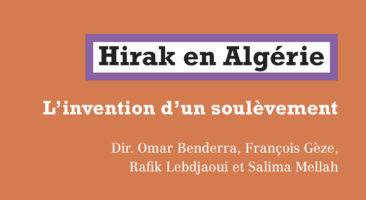Die algerischen Frauen im Krieg
Ghania Moufok, in: Peuples Méditerranéens n°70-71, janvier-juin 1995, 155-175
In Kriegszeiten ist die Information ein machtvolles Instrument für die, die es zu benutzen wissen. Der Golfkrieg ist noch im Gedächtnis präsent. Plötzlich wurde die irakische Armee von allen « relevanten » Medien in die « viertgrößte Armee der Welt » verwandelt. Folgerichtig bedurfte es, um mit ihr fertig zu werden, einer Koalition « der ganzen Welt », um einen Krieg gegen sie zu führen.
In Algerien spielt sich ein anderer, aber genauso widerlicher Krieg ab, allerdings ohne CNN. In diesem Krieg, den die Beobachter als « ohne Bilder » bezeichnen, gibt es dennoch einige Bilder, die den Weg aus Algerien finden; unter ihnen Bilder von algerischen Frauen.
Die Algerierinnen haben immer gekämpft, in der Vertrautheit ihrer Heime während des Unabhängigkeitskrieges, nach der Unabhängigkeit in Untergrundparteien, in informellen Frauengruppen, in Kinematheken, im studentischen oder gewerkschaftlichen Bereich, in den Moscheen oder vor den Gerichten. Ihre Kämpfe sind vielfältig und widersprüchlich: sie sind Kommunistinnen oder Islamistinnen, Berberistinnen oder Liberale, andere sind ausschließlich Feministinnen. Von dieser Vielfältigkeit taucht aus dem Schatten nur ein Kampf auf, der immer im Singular dekliniert wird, man nennt ihn « den Kampf der algerischen Frauen gegen den Integrismus ». Und es ist sicherlich das erste Mal in der Geschichte Algeriens, daß « die Worte von Frauen » die Schlagzeilen der algerischen oder ausländischen, insbesondere französischen Zeitungen, füllen. Während ein alptraumartiger Krieg wütet; ein Teil der Bevölkerung zum Schweigen verurteilt ist aus Angst vor bewaffneten Gruppen oder Militärs; alle großen Parteien, die aus den Parlamentswahlen von Dezember 1991 siegreich hervorgingen, dazu gezwungen sind, sich im Januar 1995 in Rom zu treffen, versammeln sich « die algerischen Frauen », demonstrieren und berichten vor den Kameras. Sollte man sich darüber freuen oder dieses erstaunliche Interesse für diesen Kampf hinterfragen?
Zuerst hinterfragen wir dieses seltsame Konzept « die algerischen Frauen ». Die Frauenassoziationen, die Mitte der siebziger Jahre ihre Anfänge machten und erst 1989 legalisiert wurden, sind heute die wichtigsten Initiatorinnen dieses Kampfes gegen den Islamismus, den sie immer als eine Gefahr für die Frauen wahrgenommen haben. Ihre wesentlichen Forderungen vor dem Abbruch der Parlamentswahlen im Dezember 1991 kreisten um die Abschaffung des Familiengesetzes und die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter.
Der Aufstieg der FIS und ihr Sieg bei diesen Wahlen, später das Auftauchen der islamistischen bewaffneten Gruppen wird sie in eine wahrhafte Verwirrung stürzen und sie in die Arme eines Regimes werfen, das ihnen nie entgegengekommen war. Ihre Standpunkte können nicht außerhalb des politischen Umfeldes, das sich nach dem Abbruch der Wahlen abzeichnete, verstanden werden. Ohne jegliche Legitimität wird das algerische Regime, indem es die Verantwortung auf sich lädt, die Wahlen zu unterbrechen und die FIS zu verbieten, sich sehr isoliert sehen, da selbst die FLN (Front de Libération Nationale) Abstand nehmen wird, wie auch die FFS (Front des Forces Socialistes). Allein einige kleine Parteien, unter ihnen die RCD (Rassemblement pour la Culture et la Democratie) und Ettahadi (eine Abspaltung der ehemaligen kommunistischen Partei) werden diese Vorgehensweise, die alle Gewalt in sich birgt, offen unterstützen. Die Assoziationen, die « den Kampf gegen den Integrismus » führen, sind heute in der Tat entweder diesen Parteien sehr nahe, deren Überzeugungen sie teilen, oder bestehen aus Frauen, die schon immer ihre politische Karriere in den Organisationen der Macht gemacht haben. Es ist ihr gutes Recht. Dies sollte jedoch nicht die tiefen Gegensätze verdecken, die sie den anderen algerischen Frauen gegenüber aufweisen, die nicht ihre Positionen teilen, einschließlich derjenigen aus der « Frauenbewegung ». Auch wenn ihr Mut unumstritten ist, sollte die Rolle, die sie den « algerischen Frauen » auf der nationalen und internationalen Bühne zuschreiben und ihre Unterstützung für die Strategie der « totalen Repression », der « totalen Sicherheit », die die algerische Armee mit dem bekannten Erfolg führt, zur Debatte stehen. « Unser Kampf ist verfälscht worden », erklärt Aicha Touati, Lehrerin und Vorsitzende der Assoziation « Frauenstimmen » in Boumerdès, « vom Kampf für die Bürgerrechte ist er verwandelt worden in den Kampf gegen den Integrismus. »
In einem nie veröffentlichten Dokument des Innenministeriums, das an die algerischen Medien gerichtet war, mit dem Titel: « Erzeugung von Ablehnung gegen den Terrorismus », kann man lesen: « der unmenschliche Charakter der barbarischen Praktiken der Terroristen muß hervorgehoben werden: Abschlachten, Angriffe auf Rettungswagen, Tod und Verletzung von Kindern, Ermordung von Eltern von Mitgliedern der Sicherheitskräfte oder in Anwesenheit von Kindern usw. »
Man muß feststellen, daß heute ausschließlich die Diskurse von Frauen, die diese Vorschriften buchstabengetreu befolgen, von der nationalen Presse mediatisiert und sodann von der internationalen Presse weiterverbreitet werden.
Wünschen Sie vergewaltigte Körper, hingerichtet von « den Integristen »? Frau Benhabyles, Vorsitzende der Assoziation der Opfer des Terrorismus in ländlichen Gebieten, ehemalige Aktivistin der UNFA (Frauenunion der Einheitspartei) und zudem ehemalige Ministerin, Mitglied des Nationalen Übergangsrates (nach dem Abbruch der Wahlen nominierte Versammlung), stellt Ihnen gerne eine besonders grauenvolle Videokassette zur Verfügung.
Wünschen Sie Bilder über « die Revolte der algerischen Frauen », von « der historischen Demonstration vom 22. März »? Das algerische Fernsehen wird sie Ihnen pflichtschuldig zukommen lassen, und alle Fotografen der Welt sind herzlich eingeladen. Wünschen Sie, am « Prozeß gegen den barbarischen Integrismus » teilzunehmen, der « spontan » von « algerischen Frauen » im Saal Ibn Khaldun organisiert wird, Sie sind willkommen. Sie brauchen nur bei der algerischen Botschaft in Paris vorbeizugehen, Schutz und Visa werden garantiert. Ihnen obliegt es dann, die « Ablehnung des islamistischen Projektes seitens der algerischen Frauen » zu bezeugen. Haben Sie selbstverständlich nicht die Geschmacklosigkeit, « während Frauen sterben », zu fragen, wie es kommt, daß der wunderbare Saal Ibn Khaldun, der unterhalb des Regierungspalastes liegt, so großzügig Organisationen zur Verfügung gestellt wird, die gestern noch als « hysterisch, verwestlicht, ohne wirkliche Verbindungen mit ihrer den arabisch-muslimischen Werten verbundenen Gesellschaft » beschimpft wurden? Fragen Sie nicht, was ehemalige Barone des Regimes, die plötzlich feministischer geworden sind als Kate Millett, in der ersten Reihe zu suchen haben? Wenn Sie sehen können, werden Sie « die Entschlossenheit der algerischen Frauen » bei der Verurteilung der « Terroristen » feststellen können. Die Inszenierung ist erbarmungslos: auf der Bühne nur Frauen und Masken. « Der integristische Terrorismus » wird durch Ali Benhadj und Abassi Madani verkörpert, die beiden Führer der FIS, die seit Juni 1991 in Haft sind und vom Militärgericht Blida zu zwölf Jahren Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Bei dieser Gelegenheit kommen sogar tote Frauen zu Wort, nachdem die Lebenden zum Schweigen gezwungen wurden. Durch den Zauber des Spektakels wiedererweckt, verlangen sie Gerechtigkeit. Ihres Lebens beraubt, durch wer weiß welche bewaffneten Gruppen, islamistischen oder anderen, schrecken die Organisatorinnen dieses Prozesses nicht zurück, ihren Tod zu instrumentalisieren, und hüten sich wohlweislich davor, wirkliche Untersuchungskommissionen zu fordern. Urteil: Madani und Benhadj werden zum Tode verurteilt. Die Geschichte wird festhalten, daß die « demokratischen » Frauen eine härtere Hand anlegen als das Militärgericht, das bestimmt nicht der Sympathie mit Islamisten verdächtigt werden kann. Im selben Moment, in dem sich diese unheilvolle Justizsimulation abspielt, überwacht Khalida Messaoudi, mal Vorsitzende der Association pour le Triomphe du Droit des Femmes (AITF), mal Vize-Präsidentin des Mouvement pour la République et la Démocratie (MPR), wie ein General im Feldzug die Organisation der Selbstverteidigungskomitees, wie sich das in der Kabylei gehört, einer « unerbittlich anti-integristischen » Region. Wie durch ein Wunder kommt eine Kamera vorbei, die diesen Moment verewigen wird, an dem die Zuschauer des französischen Fernsehens am selben Abend partizipieren werden.
Welches Interesse haben die Frauen daran, den Bürgerkrieg zu schüren?
In der algerischen Presse kann man nunmehr erschreckende Leitartikel zum Ruhm « dieser Mannsfrauen » lesen, in denen der Autor soweit geht, zu bedauern, daß « selbst die Fleischeslust ihm aus pseudo-religiösen Erwägungen verwehrt bleibe ». Wenn man diesen Schriften Glauben schenkt, scheint das einzige Hindernis für die Entfaltung der algerischen Frauen, für die Gleichheit vor dem Gesetz und sogar für die sexuelle Revolution « der Integrismus » zu sein. Bald werden wir überzeugt sein, daß die algerische Armee die Parlamentswahlen im Januar 1992 nur abgebrochen hat, um die Frauen besser befreien zu können, und daß in Wirklichkeit der einzige Krieg, der in Algerien herrscht, ein Krieg zwischen den Frauen und den GIA’s und anderen AIS’ ist.
… Und fragen Sie vor allem nicht, warum die algerische Armee das Familiengesetz nicht abschafft? Warum ergreift sie keine revolutionären Maßnahmen, die dem Mut der Frauen entsprechen, um ihnen den Status von Bürgerinnen zu gewähren? Während die Kameras laufen, gibt es immer noch so viele Frauen, die in voller Legalität verstoßen und verjagt werden aus ihren ehelichen Heimen, gibt es immer noch so viele Frauen, denen jeglicher Schulbesuch verwehrt bleibt, gibt es immer noch so viele Frauen, die unter Zwang verheiratet werden, und zwar nicht nur durch die bewaffneten Gruppen.
Im algerischen Fernsehen defilieren wie in einem Gruselkabinett die Zeugnisse der vergewaltigten Frauen. Sie tragen den Hijab und ihre Augen sind mit einer schwarzen Binde bedeckt; die Stimme verknotet, noch unter Schock, erzählen sie vom Horror der Vergewaltigung. Später verharren die Kameras auf dem Gesicht eines Vaters, dessen Leid die härtesten Herzen beben läßt, dann hört man ihn sagen: « Was bleibt mir jetzt, nachdem man meine Ehre verletzt hat? », und in Tränen fährt er fort: « Mir wäre es lieber gewesen, sie hätten sie getötet. » Diese Bilder, wenn sie sich auch zurecht gegen diese unbeschreiblichen Vergewaltigungen entrüsten, richten sich eigentlich an die Männer und appellieren an ihre Rejla (ihre Männlichkeit). Die Botschaften dieser unerträglichen Filmsequenzen sind dazu bestimmt, die Tiefen des algerischen Mannes zu bewegen, der glaubt, daß in dem Körper « seiner Frauen » seine Ehre liegt: Das Skandalöseste ist nicht so sehr die Vergewaltigung als die Schande für den Vater. Dies ist die Realität der algerischen Gesellschaft, die, sobald es sich um Frauen handelt, eher auf das Register der Tradition als der Modernität und der Citoyenneté zurückgreift. Die bewaffneten Gruppen, die die Frauen vergewaltigen, bedienen sich desselben Registers, indem sie dieses bestialische Verlangen stillen, das zum Ausdruck kommt in allen Kriegen des Okzidents oder des Orients, seit die Menschheit sich zerfleischt. Sie schreiben in Blut auf die Körper dieser Opfer des Krieges diesen alten machistischen Kodex: « Wir mißbrauchen eure Frauen, denn weil ihr euch weigert, uns in unserem Kampf zu folgen, verdient ihr nicht mehr den Status des Mannes. »
Um gegen diese Gewalt zu protestieren, demonstrieren Frauen, und was sagen sie? Sie sagen: « Ya Zeroual, ma tnechich Essaroual » (Oh Zeroual, laß nicht die Hosen runter). Für die feministischen Aktivistinnen, wie für die bewaffneten Gruppen, die Vergewaltiger, kann die Ehre eines Mannes nur in seiner Hose sein! Diese Parole richtete sich an Präsident Liamine Zeroual, als Protest gegen seine zaghaften Dialogversuche mit den Verantwortlichen der FIS, um in diesem Krieg, der das Land in ein Schlachthaus verwandelt, einen anderen Ausweg zu finden. Khalida Messaoudi erklärt dozierend:
Wenn ein Bein brandig ist, verliert man nicht seine Zeit mit Fragen, ob es amputiert werden muß, um den Körper vor einem sicheren Tod zu retten oder ob Kompressen hier und Salben da reichen, um mit dem Übel fertig zu werden. Stellen Sie sich jetzt vor, es sind welche, die Sie davon überzeugen wollen, daß zusätzlich zu den Kompressen und Salben die Lösung im Dialog mit dem Herd der Gangräne läge…
« Man verliert nicht seine Zeit », d.h. konkret, es wird amputiert, geschnitten und auf den Müllhaufen der Vergessenheit geworfen. Es wird fern der Kameras ausgemerzt und verscharrt. Bilanz des Krieges: 40 000 Tote. Dies ist eine Zahl, die schnell und ohne Atempause ausgesprochen werden muß, aus Angst vor der Frage nach der Identität dieser Zehntausende von Toten, dieses anonymen Ozeans der Gewalt, der Trauer und des Leides. Wieviele unter diesen Toten sind weder « Intellektuelle » noch « Frauen, die es ablehnten, den Hijab zu tragen »? Diese Frage zu stellen, bedeutet nicht ihren unerträglichen Tod zu relativieren, sondern es ist der Versuch, einen Krieg in seinem ganzen Grauen wahrzunehmen. Für den Krieg braucht es zwei; die Methoden und die Opfer eines Hauptakteurs werden sorgfältig vor dem Blick der Welt verborgen: der algerischen Armee. In der Tat hat auf der Waage der Medien eine Frau, die getötet wird, weil sie das Tragen des Hijab ablehnte, ein anderes Gewicht als die Frau, die getötet wird, obwohl sie einen Hijab trägt. Die überwältigende Mehrheit der algerischen Frauen sind Hausfrauen. Ihr einziger Reichtum sind zumeist ihre Kinder. Wievielen von ihnen wurde an einem Morgen der Trauer der Körper ihres Sohnes in einem versiegelten Sarg übergeben, mit dem Verbot, diesen für einen letzten Abschied zu öffnen? Wer bezeugt für sie? Allen guten Seelen, die sich um das Schicksal der algerischen Frauen sorgen und gleichzeitig jeder Friedenslösung entgegensetzen, raten wir einen Besuch auf den Friedhöfen der popularen Viertel an einem gewöhnlichen Morgen der Andacht. Sie werden dort Müttern und Töchtern begegnen, Ehefrauen und Großmüttern von Polizisten, von bewaffneten oder unbewaffneten Islamisten, die im Maquis oder unter ungeklärten Umständen den Tod gefunden haben, die während eines Auftrages oder durch einen Querschläger gestorben sind, diesen Frauen, die einen wie die anderen ihre persönliche Trauer tragend.
Wenn sie fernsehen, werden sie vielleicht eines Tages der Geschichte « Rachida, Briefe aus Algerien » begegnen, die den Kampf einer Mutter eines Polizisten und eines Islamisten erzählt. Der erste wurde ermordet, der zweite von einem Sondergericht zum Tode verurteilt. Dann vielleicht werden sie das streifen, was Worte nicht wissen. Vielleicht werden sie die Tragödie dieses Bruderkrieges nachempfinden und auch warum dieser für Rachida, die anonyme und beispielhafte Frau, nie auf eine Demarkationslinie zwischen Gut und Böse reduzierbar sein wird.
Wie also erkennt man die Opfer eines schmutzigen Krieges?
Die Instrumentalisierung des Kampfes « der algerischen Frauen gegen den Integrismus » teilt die Eigenschaften einer echten Strategie, deren wichtigster Nutznießer das Regime ist. Der Körper der hingerichteten Frauen wird benutzt ohne jeglichen Respekt für ihre entschleierte Nacktheit, für ihr Martyrium, um besser terrorisieren zu können. Salima Ghezali, Herausgeberin der Zeitung La Nation und die selbst auch aus der Frauenbewegung stammt, hat es immer abgelehnt, diese Vorgehensweise gutzuheißen, indem sie weder dem Regime noch den Islamisten recht gibt. Sie erklärt:
Für die Islamisten geht es darum, ihre Macht zu zeigen, wenn sie Frauen töten, sie wollen die Abdankung durch den Horror erzwingen. Für das Regime dient die Zur-Schau-Stellung dazu, die Abneigung und den Abscheu zu provozieren, um die Bildung von anti-islamistischen Milizen zu fördern. Von Anfang an machte sich die Presse daran, die Gleichgültigkeit der Bevölkerung anzugreifen. Dann hat man die Barbarei der bewaffneten Gruppen gezeigt und die « Feigheit der Bevölkerung » kritisiert, um sie für die Idee der Selbstverteidigung zu gewinnen und die Bevölkerung in das Lager der Macht umzulenken. Gleichzeitig hat man den Pluralismus begraben.
Es ist heute sehr schwer in einem Klima der Leidenschaft und des Grauens, für alle Algerierinnen, die wie Salima Ghezali Vernunft bewahren, sich öffentlich zu äußern, ohne Gefahr zu laufen, bestenfalls islamistischer Sympathien und schlimmstenfalls der Rechtfertigung der Verbrechen beschuldigt zu werden. In Algerien wie in Frankreich. « Louisa Hanoune kommt der FIS zur Hilfe » titelte die französische Wochenzeitung L’Évènement du Jeudi einen Artikel von Martine Gozlan, die jegliche journalistische Zurückhaltung zu verlieren scheint, wenn man ihr vom « Dialog mit den Islamisten » spricht. Was wirft sie Louisa Hanoune, Sprecherin der Arbeiterpartei (PT), vor? Die Plattform von Rom unterschrieben zu haben, neben der FIS, der FLN und der FFS, um « dem Frieden eine Chance zu geben ». Völlig benommen von ihren alten Wahnvorstellungen, ihrer Angst vor dem Islam, der per Definition eine gewalttätige Religion sein soll, verharren gewisse französische Intellektuelle in ihrer Taubheit gegenüber jeglicher Idee des Dialogs mit den Islamisten, wenn sie nicht sogar das rechtfertigen, was Péroncel Hugoz als Sankt Bartholomäus gegen diese politische Strömung bezeichnet. In Algerien, so sagt man uns, besteht der Kampf zwischen der Moderne und dem Mittelalter. In Wirklichkeit läuft ein Krieg zwischen Schnauzbärten und Bärten, in dem die Frauen ein Einsatz sind. Sie sind der Ort der Identität, um die sich zwei hegemoniale und totalitäre Bestrebungen streiten, die gleichermaßen weit von der Demokratie entfernt sind. Die Debatte über die Art der algerischen Frauen, sich zu kleiden, ist eine ausgezeichnete Illustration davon. Nennen wir sie Meriem, ein fiktiver Name für eine wahre Geschichte. Sie lehrt an der Universität Algier; jeden Tag begibt sie sich zur Arbeit ohne Hijab und jeden Tag fürchtet sie um ihr Leben, weil bewaffnete Islamisten entschieden haben, daß eine ehrenhafte Frau eine verschleierte Frau ist. In ihrer Klasse trotzen Studentinnen mit Hijab, wie sie, jeden Tag dem Verbot der bewaffneten Gruppen, die verlangen, daß die Universität geschlossen wird. Eines Tages bricht eine von ihnen zusammen und in Tränen erzählt sie Meriem, daß sie in einem sogenannten heißen Viertel wohnt und daß jeden Morgen, wenn sie zur Universität geht, die gleiche Militärsperre auf sie Druck ausübt, damit sie den Hijab ablegt: « Finden sie das gerecht? », fragt sie ihre Dozentin. « Und daß man mich zwingt, den Hijab zu tragen, finden sie das gerecht? », antwortet Meriem. Wer schert sich in dieser Debatte um die freie Wahl der Frauen, um ihr freies Bewußtsein? Man wird vielleicht von einem demokratischen Projekt in Algerien sprechen können, wenn akzeptiert wird, daß eine Frau frei ist, sich zu kleiden, wie sie es will, die politische Strömung zu wählen, die aufgrund ihres sozialen, emotionalen und individuellen Weges ihr entspricht. Jede Bevölkerung hat ihre Geschichte, und irgendwo in den Tiefen des Gedächtnisses, erinnert man sich, daß in Algerien in den fünfziger Jahren die Ehefrau des General Massu und ihre « indigenen » Ersatztruppen Kampagnen durchführten zur Entschleierung der Frauen unter dem Himmel der Kolonien.
Daß das algerische Regime die Forderungen der Frauen nach Gleichberechtigung benutzt, um im nachhinein seine Strategie zu rechtfertigen und die Macht zu bewahren, ist politisch konsequent. Es führt einen Krieg und alle Waffen eignen sich, um ihn zu gewinnen. Aber wenn französische Intellektuelle wie André Glucksmann oder Bernard Henri Levy sich zum Echo der Instrumentalisierung dieses Kampfes machen, fragt man sich, von welchem Krieg sie sprechen. Was in Algerien auf dem Spiel steht, ist nicht die Zukunft des französischen Modells, sondern die Zukunft einer Nation, die nicht Frankreich ist. Es ist die Zukunft einer Nation, die sich in Gewalt und Grauen entscheidet, nach dreißig Jahren Militärregime im Auftrag der Einheitspartei, hundertreißig Jahren Kolonisation; Fragen, die sich ihr mindestens seit den dreißiger Jahren stellen. Welchen Platz nimmt der Islam in einem muslimischen Land ein? Welche Art von Institutionen muß aufgebaut werden, damit die Vielfältigkeit unserer Geschichte respektiert wird? Was ist die Rolle einer Armee? Welchen Raum für die berberische Sprache und Kultur? Welchen Stellenwert haben die Bürger, Männer und Frauen? Was muß getan werden, um nicht mehr arbeitslos zu sein, bis zum Selbsthaß und sodann bis zum Haß auf andere? Welche sind unsere Beziehungen zur Welt, die uns umgibt, wenn sie uns nicht mit ihrem IWF und ihrer Weltbank in die Armut zwingt? Wie tritt man in das globale Dorf ein, ohne seine Seele zu verlieren? In diesem Krieg geht es nicht nur um das Schicksal der Frauen und das Familiengesetz, es geht um die Frage der Zugangsweisen zum Status des Bürgers für alle Algerier, Männer und Frauen.
Die Gefühle zu manipulieren, das ist das beste, um eine Analyse zu vermeiden, die dem Verstehen dient und Lösungen in Betracht zieht, die weniger Menschenleben, Haß und schwerwiegende Brüche kosten. Lösungen, die von einer Zukunft zu sprechen verstünden, für ein erschöpftes Land, müde, seine politischen Rechnungen mit den Waffen zu begleichen… In Algerien sind 70% der Bevölkerung unter zwanzig Jahren und sie sind es, die das Kanonenfutter liefern.