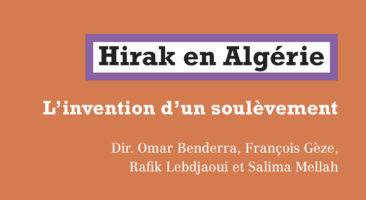Algerien: Kolonialer Diskurs einst und heute
Salima Mellah, Silsila 5 (1995)
Außerdem hat die westliche Bourgeoisie ihre Verbündeten unter den unterdrückten Nationen Afrikas, Asiens und Südamerikas. Das liegt daran, daß sie innerhalb der Kolonien, Halb- und Neo-Kolonien eine eingeborene Elite herangezüchtet hat, die durch Jahre rassistischer kultureller Manipulationen von einem beinahe pathologischen Selbsthaß und einer ebensolchen Selbstverachtung erfüllt ist. Der Rassismus hat somit eine Elite produziert, die, wie Fanon das einmal beschrieben hat, von dem unheilbaren Wunsch beseelt ist, sich permanent mit dem Westen zu identifizieren.
Ngugi wa Thiong’o
In diesem Aufsatz sollen einige Elemente der militärischen, politischen und kulturellen Konfrontation herausgegriffen und anhand dieser die Kontinuität des antiislamischen Rassismus, sowie die Ausformung spezifisch auf Algerien zugeschnittener Mythen, von denen manche sich bis heute wiederfinden lassen, erläutert werden.
Die « Neue Welt » in Algerien?
Es kann wohl angenommen werden, daß 1830 – Beginn der französischen Eroberung Algeriens – kein ausformuliertes Projekt der Kolonisierung Algeriens bestand, auch wenn manche Ideologen, Politiker und Militärs sehr wohl von Anfang an das Land « befriedet » sehen wollten, um europäische Siedler anzulocken. Der algerische Historiker Lacheraf bemerkt, daß für die Militärs « das Ideal das Amerika der Plantagen und der Sklaven Maroons1 bleibt, sowohl hinsichtlich der Methoden der Kolonisierung, wie der Repression. »2 Die damaligen Ausführungen über ein menschenleeres, nicht bebautes Land machen diese Absicht nur deutlicher. Die Rechtfertigungen für eine Invasion Algeriens, die in vielen Büchern bis heute nachzulesen sind, erwähnen die Notwendigkeit, die algerischen Piraten im Mittelmeer auszuschalten, weil diese den Handel und den Schiffsverkehr behindern würden. Daß diese sogenannten Piraten nichts anderes als algerische Seefahrer waren, die die Monopolstellung der Europäer gefährdeten und deshalb verfolgt und beseitigt werden sollten, wird dabei geleugnet. Die europäischen Seekräfte hatten schon viele Jahre zuvor den algerischen Seehandel durch Raub und Bombardierungen der Flotten fast zum Erliegen gebracht, so daß 1830 wohl kaum eine Gefahr von diesen auf dem Mittelmeer zu erwarten war.3 Dieser Mythos wurde jedoch gepflegt und immer weiter reproduziert, weil er für das Gesamtbild, das über den « Algerier » geschaffen wurde, von Nutzen war, und eine derartige Aggression rechtfertigen sollte.
Algerien den Militärs…
In den ersten Jahren der Eroberung sind es vor allem die Militärs, die das Land « erkunden » und das koloniale Wissen über Landschaften, Menschen, Sitten und Sprachen entwickeln. Neben den rein militärischen Aufgaben werden sie schnell zu Verwalter, Richter, Händler und Forscher. Sie durchqueren das Land (in den ersten dreißig Jahren fast ausschließlich den Norden), verwüsten es, indem sie ganze Dörfer und Städte zerstören, die Bewohner vernichten, verjagen oder enteignen, die Herden dezimieren oder rauben, die Felder verbrennen, die Häuser plündern und manchmal die Menschen in Höhlen einsperren und ausräuchern. Das Vernichtungsprojekt mit seinen Theoretikern der Exterminierung und Zwangsumsiedlung ist schon in den Anfängen der Eroberung erkennbar, wie folgender Brief eines Offiziers deutlich zeigt: « Sie fragen mich […] was wir mit den Frauen machen, die wir festnehmen. Wir behalten einige als Geiseln, die anderen werden ausgetauscht gegen Pferde und der Rest wird versteigert wie die Tiere (in der Truppe) […] Alle Männer bis zum 15. Lebensjahr töten, alle Frauen und Kinder nehmen, sie auf Schiffe laden, sie zu den Inseln Marquises oder anderswohin schicken; mit einem Wort, alles vernichten, was nicht vor unseren Füßen wie die Hunde kriecht. »4
Der Widerstand auf algerischer Seite formiert sich von Anfang an und führt zu manchen Niederlagen der französischen Armee. Den stärksten und organisiertesten Widerstand leistete ohne Zweifel Emir Abd-El-Kader, dem es gelang weite Landstriche mit ihren Chefs und Bevölkerungen zu vereinen, wiederaufzubauen und unter eine einzige religiöse Autorität zu stellen. Die französische Armee erlitt massive Rückschläge und sah sich gezwungen mit dem Emir Verträge zu schließen, die ihre Kontrolle über den Großteil Algeriens verhinderte. Erst die massive Verstärkung der französischen Truppen auf über 70 000 Soldaten, der Bruch der vereinbarten Verträge und die systematischen Vernichtungsfeldzüge führten zur Niederlage Abd-El-Kaders 1847. Nicht allein die militärischen Schläge, sondern vor allem die Zerstörung der algerischen Wirtschaft und die daraus folgenden Hungersnöte schwächten die algerische Gesellschaft ungemein. Die Ausrottung der Bevölkerung war erklärtes Ziel der Armee, die selbst nach der Zerschlagung und Inhaftierung des Emirs weiterhin mit zahlreichen Aufständen konfrontiert war. Die Armee wurde nochmals vergrößert auf knapp 110 000 Soldaten (ein Soldat für 30 AlgerierInnen) und mußte vor allem gegen den ungebrochenen Widerstand in der Kabylei kämpfen. Erst 1871-72 waren die größten Aufstände gebrochen, doch selbst in den Jahren danach entflammten immer wieder Revolten.5
Am Ende dieses blutigen Eroberungskrieges ist über eine Million von etwa 4 Millionen AlgerierInnen durch Krieg, systematische Vernichtung, Epidemien und Hunger umgekommen (allein zwischen 1866-70 sterben 600 000 AlgerierInnen durch Epidemien und Hunger!).6 Die Städte waren entvölkert und sollten erst 20 bis 40 Jahre später die Bevölkerungszahl von vor 1830 erreichen; die städtische Wirtschaft und das Handwerk waren völlig zerstört; die Viehzucht, eine der wichtigsten Aktivitäten des Landes war durch Vertreibung, Raub oder Tötung der Tiere auf weniger als ein Drittel dezimiert. Die Landwirtschaft war nicht nur massiv zurückgegangen, wegen der Kriege, der Brandstiftungen und der Flucht der Bauern, sondern auch durch Enteignungen, kraft derer den Europäern die besten Böden zugeteilt wurden.
…und den Missionaren
Sehr früh gesellen sich zu den Militärs die Missionare. Sie liefern dem militärischen Projekt seine religiöse Legitimation, weil es sich – wie Mgr. Lavigerie, Erzbischof von Algier, klar ausdrückt – dabei um einen riesigen Kreuzzug handelt, in dem Frankreich der Soldat ist, der über die Sahara hinweg ganz Afrika dem Evangelium darbieten wird.7 Die « Gesellschaft der Missionare von Afrika » auch « Pères blancs » genannt, wird von Lavigerie 1867 ins Leben gerufen und 1874 endgültig etabliert. Was sie kennzeichnet, ist die Anpassungsfähigkeit ihrer Mitglieder an die kulturellen und klimatischen Umstände: Sie lernen nicht nur Arabisch oder Berberisch, sondern befassen sich mit den einheimischen Sitten und Gewohnheiten, tragen die Kleidung und versuchen so in der Gesellschaft unterzutauchen. Dabei vergessen sie nie ihren Auftrag, der neben der Missionierung vor allem darin besteht, die Vorhut der Durchdringung zu sein. Sie wagen sich als erste in den Süden, da sie den Wunsch verfolgen, Verbindungen in den Senegal herzustellen. Dabei stoßen sie auf die Ablehnung der Bevölkerung und viele dieser Pioniere verlieren bei ihren Unternehmungen ihr Leben.8 Schon vor den Pères blancs hatten sich christliche Orden in Algier niedergelassen, und die Militärs erkannten gleich zu Anfang « die großen Beziehungen », die Mönche und Soldaten verbanden. Marschall Bugeaud betonte seine Überzeugung, daß « die Tugenden und die guten Taten der Trappisten, das Herz der Araber für uns gewinnen helfen, die wir mit der Gewalt der Waffen unterworfen haben. »9
Die dritte Gruppe, die zu der kolonialen Konzeptualisierung Algeriens beigetragen hat, bilden die Ökonomen oder die Sozialisten, der einige Militärs angehörten und die in der Eroberung Algeriens eine Möglichkeit sahen, ihre Ideen und Vorstellungen des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft zu verwirklichen (Saint-Simonisten). Natürlich hatten in diesen Entwürfen die AlgerierInnen keinen Platz. Und schließlich als letzte Gruppe wären noch die Forscher und Geographen zu nennen, die vielleicht als die Vorboten der Orientalisten gesehen werden können, weil sie mit ihren ersten Entdeckungsreisen und der Literatur, die sie produzierten, den Weg bereiteten für das, was später die wissenschaftliche Erfassung des Orients werden sollte.
Das Siedlungsunternehmen
Ich werde nicht auf die kolonialen Institutionen näher eingehen, die das Leben der AlgerierInnen bis in ihren Personenstand festschreiben sollten, noch werde ich das politische System in Algerien beschreiben. Worauf es uns hier ankommt, ist, den kolonialen Diskurs zu beleuchten.
Doch vorher einige Sätze zu dem Siedlungsprojekt. In den Anfangsjahren scheiterte die Ansiedlung von Franzosen und die Bewirtschaftung der Böden fast gänzlich. Die Zahl der Siedler war bis in die 1840er Jahre sehr gering und die Kolonisten mußten mit großzügigen Angeboten angelockt werden.10 Doch selbst die vom Kolonialstaat geförderte Besiedlung, die große Zentren vorsah, wichtige finanzielle und materielle Hilfen und Berater bereitstellte, schlug fehl. Die Siedler waren keine Landwirte, oft waren sie Deportierte von 1848, die sich nur schwer der neuen Umgebung anpassen konnten, sie bearbeiteten nicht selbst die Böden, sondern vermieteten sie an Algerier. Jahr für Jahr wurden immer mehr Böden von den Europäern usurpiert und die Bauern verdrängt oder in ein menschenverachtendes Abhängigkeitsverhältnis gezwungen.
Die Legitimierung der kolonialen Unternehmung
Bis 1872 etwa besteht die koloniale Literatur aus den Beschreibungen der Militärs, die Bemerkungen und Beobachtungen über die einheimische Bevölkerung festhalten, da es wichtig war, sie besser zu kennen, um sie zu unterwerfen. Gewisse « Wahrheiten » mußten geschaffen werden, um diese aggressive, gewalttätige Unternehmung zu rechtfertigen. Die Geschichte über die Piraten, die ausgeschaltet werden müßten, um endlich einen friedlichen Handel auf dem Mittelmeer zu treiben, wird noch erweitert, schon geht es um die Aufgabe Frankreichs die Gebiete der ehemals römisch-christlichen Welt zu befreien und wieder an die okzidentale Zivilisation anzuschließen. Frankreichs Einsatz wird dargestellt als Befreiung des algerischen Volkes von der türkischen Despotie. Als Erbe des Universalismus bringen die Franzosen die Zivilisation. Die angetroffenen Menschen in Algerien sind gewalttätige Barbaren, für viele französische Reisende eindeutig biologisch bedingt, wie folgendes Zitat von 1892 verdeutlicht: « man darf nicht aus dem Auge verlieren, daß alles bei den Arabern nur Instinkt und Impulsivität ist, weil das Kleinhirn die wenig entwickelten, frontalen, geistigen und intellektuellen Gehirnwindungen beherrscht… Heute kann ihr Gehirn (der Muslime) nicht ab der ersten Generation unsere wissenschaftlichen Schlüsse oder unsere hohen historischen und philosophischen Konzeptionen erfassen. »11
Religiöse und ethnische Differenzierungen
Schon sehr früh tauchen zwei Unterscheidungsmerkmale auf, das eine religiös, das andere ethnisch. Aufgrund der sprachlichen Unterscheidungen zwischen Berber/Kabyle und Araber, konstruieren die Anthropologen Rassen, die besser oder schlechter zivilisierbar seien: Die Araber hätten Nordafrika mit dem Schwert erobert und die Berber gezwungen, den Islam anzunehmen. « Alles bereitete Afrika für die härteste und grausamste Eroberung vor, die es noch erleiden würde und die es für Jahrhunderte lang in eine unheilbare Barbarei stürzen wird: die muslimischen Araber stürzten sich darauf mit diesem Ungestüm, das ein Jahrhundert lang die Unterwerfung bedeutete und das erst vor dem Schwert von Charles Martel, in den Ebenen von Poitiers Halt machte. »12 Die französischen Invasoren identifizieren sich selbst mit den « Opfern » der islamischen Eroberung. Sie entdecken den Kabylen, seßhafter Bauer in den Bergen, der in Algerien schon vor dem Eindringen des Islam lebte und auch nur sehr oberflächlich seine Grundsätze und Regeln angenommen haben soll. Im Grunde sei der Kabyle dem französischen Bauer aus der Provence sehr viel näher als dem barbarischen Araber, allein schon seine hellere Hautfarbe zeuge von dieser Verwandtschaft. Frankreich müsse ihn nur erziehen, damit er zum echten Franzosen wird. Auch hier spielen die Missionare eine wesentliche Rolle. Ihre Bekehrungs- und Französisierungsversuche veranlaßte sie, Waisenkinder aufzunehmen, sie zu taufen, ihnen französische Namen zu geben, den Frauen das Tätowieren zu verbieten, weil es dem französischen Schönheitsideal nicht entsprach, und sie mit Franzosen zu verkuppeln, damit ihre Nachkommenschaft das Weiterleben der französischen « Rasse » garantiert. Diese Initiativen sind jedoch nicht weit gediehen, da die Kabylen sich dem widersetzten.13
Antiarabischer Rassismus
Mit der « Befriedung » der Kabylei nach den Aufständen zwischen 1851 und 1871 schienen die Aufgaben der Militärs erfüllt zu sein. Sie hatten Untersuchungen über « den Feind » angestrengt, um diesen besser kennenzulernen und ihn nach seiner Niederschlagung besser zu porträtieren. Eine zivile Verwaltung wurde nun eingesetzt, die die AlgerierInnen unter die Willkür der Siedler stellte. Nun wurden die gemachten Beobachtungen schriftlich niedergelegt und kodifiziert und erhielten den Charakter eines Gesetzestextes.
Nach der Niederschlagung des Widerstandes war der Algerier nicht mehr der politische Rivale oder militärische Konkurrent, sondern, indem er auf eine Abstraktion reduziert wurde, verkörperte er die Negation schlechthin. Ein entmenschlichtes Wesen, das nur noch Eingeborener oder Barbar sein konnte, beflügelt die Anthropologen, die ihre wissenschaftlichen Arbeiten den ideologischen und politischen Notwendigkeiten unterwerfen.
Die dichotome Konzeptualisierung erhält immer mehr wissenschaftlichen Nachdruck: die moderne Gesellschaft steht der barbarischen gegenüber. Das Thema der « Differenz » wird rationalisiert, das Konzept der « Verspätung » tritt auf, die « Unterentwicklung » nicht nur im ökonomischen Bereich sondern auch in Bezug auf die Kultur wird hervorgehoben. Eine Reihe von Themen dienen zur Bekräftigung dieser Postulate. Wie wir schon gesehen haben erhält die Unterscheidung Araber/Kabyle eine rassische Untermauerung. Ihr gesellt sich die historische bei: die Kabylen seien die Nachfahren der Römer. « Je mehr man in diesem alten Stamm, je mehr man unter der muslimischen Rinde kratzt, findet man den christlichen Saft. Dann erkennt man, daß das kabylische Volk – zum Teil germanischen Ursprungs und früher vollkommen christlich – sich nicht völlig mit seiner neuen Religion verwandelt hat. Unter dem Schlag des orientalischen Schwertes hat es den Koran akzeptiert, aber nie angenommen; es hat sich mit dem neuen Dogma wie mit dem Burnus gekleidet, aber es hat darunter seine vorherige soziale Form behalten, und nicht nur mit den Tätowierungen seines Gesichts, breitet es ohne es zu wissen, vor uns das Symbol des Kreuzes aus. »14
Mit dem Begriff « Araber » werden eine Reihe Assoziationen konstruiert, die dazu dienen, diesem ausschließlich zerstörerische Eigenschaften zuzuteilen. So sind die Araber nicht nur Muslime, sondern auch Nomaden, eine Gesellschaftsstruktur, die das Archaische und Wilde in sich trägt und einzig und allein zu Aggressionen fähig sei, wie die muslimische Invasion in Nordafrika es bewiesen haben soll. Ein weiterer Gegensatz, der der Untermauerung der barbarischen Natur des Arabers/Muslims dient, ist die Desertifikation versus Fruchtbarmachung oder Nomade versus Seßhafter. Die Seßhaftigkeit ist die Grundlage der Zivilisierung, der Zivilisierbarkeit, während das Nomadentum die Verwilderung, d.h. die Wüste hervorbringt. Diese ideologische Unterscheidung dient im Grunde der Rechtfertigung der Kolonisation. Araber wie Franzosen waren Invasoren, aber während erstere nur Zerstörung, Raub und rauhe Sitten eingeführt hätten, seien letztere die Befreier, die das zivilisatorische Werk der Römer fortsetzten, indem sie der türkischen und muslimischen Tyrannei ein Ende setzten und das brachliegende Land wieder fruchtbar machten. In dem Zusammenhang betonen die Ideologen der Kolonisation gerne, daß vor ihrer Ankunft in Algerien kein Staat und keine Nation existiert habe und sie diejenigen seien, die diesen Segen in der chaotischen und anarchischen Region eingeführt hätten.
Der Islam als Wurzel allen Übels
Nachdem die ethnische Unterscheidung zwischen dem Araber und dem Berber in ihrer praktischen Umsetzung der Assimilationspolitik gescheitert war, verringern sich die Abhandlungen über den europäischen Ursprung der Berber. Die Unterscheidung wird allerdings weiter gepflegt im Rahmen der Teile-und-Herrsche-Politik.
Mit der großen Aufgabe der zivilisatorischen Mission betraut, verfängt sich die koloniale Legitimationsstrategie um die Jahrhundertwende in Widersprüchen. Einerseits ist aus humanistischen Gründen, die Notwendigkeit erwachsen, die algerische Gesellschaft zu verändern und aus dem Eingeborenen einen Franzosen zu machen, und andererseits ist die Beherrschung und Kontrolle über die AlgerierInnen notwendig und einfacher, wenn diese als « Sujets » (Untertanen) deklariert werden. Das koloniale System kann nur so lange existieren, wie es an seinen rassistischen Grundlagen festhält. Der alte Gegensatz Islam versus Zivilisation erfährt immer wieder neuen Aufwind. Zahlreiche Schriften werden verfaßt, die allein zu beweisen versuchen, daß der Islam der Grund für die Rückständigkeit der Eingeborenen sei. Der Begriff « Islam » erhält immer mehr eine rassistische Bedeutung. In Bezug auf die viel diskutierte Assimilationspolitik wird deutlich, daß nur diejenigen in die « Grande Nation » aufgenommen werden würden, die sich soweit von ihrem islamischen Hintergrund entfremdet haben, daß die Bezeichnung Muslim schon gar nicht mehr zutreffen kann: « Man räumte keine Möglichkeit tiefer Reformen ein, außer im Rahmen der französischen Staatsangehörigkeit, d.h. der Einbürgerung. Die Rechte des Bürgers sollten ausschließlich dem ‘évolué’ (entwickelten Eingeborenen) zugesprochen werden, und – wie ein damaliger Senator 1924 äußerte – ‘der Arabo-Berber wird sich so lange nicht entwickeln, wie er islamisch bleibt, da die Doktrin des Islam sich für eine Entwicklung nicht eignet.' »15
Die Unterdrückung der Musliminnen
Zwei Themen kehren in der Verurteilung der islamischen Gesellschaft immer wieder: das erste betrifft die weibliche Welt und durch sie, das gesamte soziale System. Es wird dekretiert, die Frauen seien abhängig, minderwertig, in einem Zustand der halben Sklaverei. Die Abhandlungen über die schlechte Behandlung der Frauen durch die muslimischen Männer sind zahlreich und die Tendenz ist deutlich, sie zu Opfern des personifizierten Islam zu machen. Sie existieren als Subjekte überhaupt nicht, so hätten sie auch keine Religion. Frankreich sieht seine große Aufgabe in der Emanzipation der Frauen durch Gesetze und Bildung. Die politische Intention ist das kulturelle Rückgrat der Gesellschaft durch das Eindringen in die Familien zu brechen. Je mehr angenommen wurde, daß die Frauen eine wesentliche Funktion in der Bewahrung der Familienzusammenhänge und der Überlieferung von kulturellen Bezügen trugen, umso mehr wurde von kolonialer Seite aus versucht, auch mittels des « richtigen Islam », den die europäischen Juristen von « jedem Aberglauben und magischen Praxen » zu befreien trachteten, sie zu erreichen: « Die Aufgabe der französischen Gerichte besteht darin, die Interessen der muslimischen Frau mit den dringenden Erfordernissen des islamischen Gesetzes in Einklang zu bringen. »16 Mit diesen Eingriffen in das Gewohnheitsrecht, das sowohl auf dem islamischen Gesetz wie den gelebten lokalen Traditionen beruht, soll ins Innerste der Gesellschaft ein Keil getrieben werden: « Über die Frauen können wir die Seele eines Volkes gewinnen. »17 Der Mythos der Muslimin, die nur darauf wartet, daß die rettende Hand sie vom muslimischen Joch befreit, wird schnell geboren und für Generationen seine VertreterInnen finden: « Wir müssen die größte Rücksicht für die Frau der Stämme haben: ich habe sichere Beweise, daß sie intelligenter ist als ihr vorgeblicher Herr; sie hat uns erkannt; sie wendet sich instinktiv an unsere Autorität; sie präsentiert meistens unsere Intervention als wünschenswert und sieht in uns eine Unterstützung und einen Rückhalt; durch sie wird es uns endlich am sichersten gelingen, die Kinder Ismaels zu zivilisieren. »18
Auch hier wird gerne die Unterscheidung zwischen Berberin und Araberin gemacht. So seien die Frauen allgemein empfänglicher für den Fortschritt, doch ihre Männer bremsen sie mit ihrem Islam: würde ein « Mustapha Kemal in Algerien von heute auf morgen die Emanzipation der Frauen ausrufen, hätte er große Schwierigkeiten sich bei der arabischen Frau Gehör zu verschaffen; ich glaube, daß die kabylische Frau sofort konvertiert wäre. »19 Emanzipation ist somit zugleich die Befreiung von den Männern und vom Islam!
Der islamische Fanatismus
Ein zweites beliebtes Thema im Arsenal der antiislamischen Propaganda ist der Fanatismus der Muslime. Da sie nichts anderes hervorgebracht hätten als ihre Religion, seien die Muslime fanatisch und unfähig sich dem Fortschritt und der Zivilisation zu öffnen. Die damalige Überzeugung lautete: « der Muslim ist ein unheilbarer Fanatiker ». Einmal so definiert können ihm alle erdenklichen unmenschlichen Eigenschaften zugesprochen werden, da mit dem Begriff « Fanatiker » die Negation des rationalen, überlegten, schöpferischen und humanistischen Europäers konzeptualisiert wird. « Intellektuell ist der Muslim ein Gelähmter. Sein Hirn, das im Laufe der Jahrhunderte der rauhen Disziplin des Islam unterworfen war, ist allem, was nicht vom religiösem Gesetz vorgesehen, verkündet und spezifiziert wurde, verschlossen. Er ist also gegenüber jeder Neuerung, jeder Veränderung, jeder Innovation systematisch feindlich gesonnen […] Der Muslim, der seiner Religion treu geblieben ist, ist nicht fortgeschritten; er ist unverändert geblieben, inmitten der Entwicklung aller anderen Zivilisationen. In der Tat ist eins der hervorstechenden Züge des Islamismus, die Rassen, die er unterworfen hat, in ihrer angeborenen Barbarei zu immobilisieren […]. Trotz der äußeren Erscheinungen bewahrt er seine Mentalität, seinen tiefen Glauben, seinen lebendigen Haß. Er ist ein Widerspenstiger vor jeder Zivilisation. »20
Dieses Stereotyp wird über die gesamte Kolonialzeit hartnäckig aufrechterhalten, weil sich damit das brutale Vorgehen der Kolonialmacht rechtfertigen läßt. Gewiß lösen sich verschiedene Variationen dieses Themas ab, um sich der Wechselbeziehung Herrschaft und Widerstand anzupassen. Gegenüber den kriegsbesessenen und blutrünstigen Arabern/Muslimen, die immer für « Heilige Kriege » zu gewinnen seien, doch keine höheren Ziele verfolgten, erscheinen die Europäer einen pazifistischen und zivilisatorischen Kampf zu führen. So heißt es: « Der Heilige Krieg ist das Ziel, auf den die Wünsche und Bemühungen des Arabers ausgerichtet sind. »21 Dieser Fanatismus wird je nach Epoche von den islamischen Bruderschaften, dem mystischen Islam oder in diesem Jahrhundert von den muslimischen Reformisten oder Nationalisten verkörpert. Der Diskurs über den religiösen Fanatismus erhält eine solche Bedeutung, daß er oft als ein Krieg der Religionen begriffen wird. Der Bezug zu den Kreuzzügen ist explizit oder implizit immer vorhanden. Lacheraf zeigt auf sehr anschauliche Weise, wie die Eroberung Algeriens als ein Akt der zivilisatorischen Mission verstanden wurde, die sich in der Tradition der christlichen Heiligen Kriege bewegt, in der Soldat und Missionar ineinander verschmelzen. « Ein französischer Reisender, der mit Marschall Bugeaud und dem Bischof von Algier, Mgr. Dupuch, sehr befreundet war, schrieb 1844 – also auf dem Höhepunkt der Eroberung – einen Reisebericht, der gleichzeitig ein apologetisches Essai über die christliche Berufung Frankreichs in Algerien ist. Hier die Worte, die er wiedergibt von einem Gespräch mit Bugeaud: ‘Was machen wir in Afrika?’ sagte mir vor zwei Jahren Herr Marschall Bugeaud in seinem Salon in Algier; ich antwortete ihm: ‘Sie setzen das Werk von Godefroy, von Louis VII und von Saint Louis fort’22 […] ‘Unser Afrikakrieg ist also eine Fortsetzung der Kreuzzüge.' »23 Dieser Krieg könne niemals ein gewöhnlicher sein, denn er verfolge eine heilige Absicht. Deswegen können die Methoden der Durchführung noch so grausam sein, die Mission rechtfertigt sie: « Das Ziel des Afrikakrieges ist höher und heiliger als das Ziel unserer europäischen Kriege. […] Das, was auf dem Spiel steht, ist die heilige Sache der Zivilisation, die unsterbliche Sache der christlichen Idee, der Gott das Reich auf Erden versprochen hat und deren französische Statthalterschaft von der Vorsehung bestimmt ist. »24 Das Zusammenspiel zwischen der Missionierungsarbeit der Kirche und der verschiedenen Kongregationen auf der einen Seite und der Erziehungs- und Zivilisierungsaufgaben des Staates andererseits kennzeichnet die gegenseitigen Beziehungen und hat dazu geführt, daß die jeweiligen legitimatorischen Diskurse sich immer vorzüglich ergänzt haben.
Der Anfang vom Ende der kolonialen Suprematie
Die Jahrhundertwende kann wohl als der Höhepunkt des französischen Kolonialismus in Algerien datiert werden. Hier und da entflammten noch Aufstände und zeigten damit dem Besatzer, daß das Land noch nicht « befriedet » ist und daß er nur eine relative Ruhe um einen sehr hohen Preis genießen konnte. Nach der Zerschlagung der großen Revolte in der Kabylei 1871 und der anschließenden massiven Repression verlagert sich der Widerstand vom Land auf die Städte. Die AlgerierInnen sind jedoch so stark einer allumfassenden Herrschaft unterworfen, daß selbst das nach dem islamischen Gesetz geregelte Personenstandsrecht von Kolonialrichtern gesprochen wird.
In Frankreich dringt die koloniale Ideologie immer tiefer in das nationale Bewußtsein ein und keine Partei, keine Bewegung stellt das Unternehmen in Frage. Im Gegenteil, während des ersten Weltkrieges werden sich viele über den Wert der Kolonien bewußt, in denen Soldaten und Arbeitskräfte rekrutiert werden können. Bei den zurückkehrenden algerischen Soldaten entsteht immer mehr Unmut über ihre Lebensbedingungen, da ihnen Versprechungen gemacht wurden, die nie gehalten wurden. Die Erfahrungen der Arbeitsmigranten in Frankreich führen auch dazu, daß viele sich über ihren unterschiedlichen Status in Algerien und in Frankreich bewußt werden. Während in Algerien selbst eine kleine gebildete Schicht von Algeriern aktiv wird und Reformen fordert, entsteht eine proletarische Bewegung in Frankreich unter den Arbeitern, die geführt von Messali Hadj schon sehr bald (1925) für die Unabhängigkeit Algeriens kämpft.
Zerstörung der algerischen Bildungsinstitutionen
Die Bildung für die Algerier war in den ersten Jahrzehnten der Kolonisierung erheblich zurückgegangen,25 da sehr viele Institutionen geschlossen, zerstört oder vernachlässigt wurden. Vor allem in den Städten waren die Verwüstungen der Schulen am massivsten betrieben worden.26 Die französischen Verwalter standen den algerischen Lehrern sehr mißtrauisch gegenüber und waren der Überzeugung, daß « die meisten Ungebildete sind, die glauben, daß ihre Aufgabe darin besteht, den jungen Schülern die Aversion gegenüber allem Christlichen einzuflößen. »27 Sie wollten sich das Monopol der Schulbildung aneignen und kontrollierten die Lehrer nach ihren Abschlüssen und ihrer Loyalität. Säuberungen fanden statt, die von Geldstrafen bis zu Kündigungen und Deportationen reichten. Die traditionelle Schulbildung sollte absterben und « besser ist es die Araber ihrer natürlichen Neigung folgen zu lassen, nichts zu lernen »,28 zumindest bis ein Unterricht organisiert würde, der den Widerstand bricht und den Interessen der französischen Herrschaft dient. Die Assimilierungs- und Laizisierungspolitik sollte zur Folge haben, daß die Koranschulen sehr streng begrenzt und kontrolliert wurden. Die Einschulungen in französischen Schulen waren jedoch gering und stießen lange auf Ablehnung in der algerischen Bevölkerung. Auch viele französische Lokalverwalter lehnten die Einführung von Schulen ab, da sie sie für gefährlich befanden, könnten doch die « Eingeborenen » die Forderung erheben « Algerien den Arabern! »29 So ist, wie Lacheraf schreibt, Algerien systematisch entintellektualisiert worden.
Auch die religiöse Praxis wurde sehr stark eingeschränkt. Die koloniale Administration führte eine Art islamischen Klerus ein, mit Funktionären, die in drei französischen Schulen ausgebildet, vom Staat angestellt und entlohnt wurden. Sie sollten die Aufgaben in den Moscheen übernehmen und vor allem den Einfluß der religiösen Bruderschaften in der Bevölkerung eindämmen. Als jedoch ersichtlich war, daß der « offizielle » Klerus wenig Macht und Kontrolle ausüben kann, richteten sich die Bemühungen auf die « Vorgesetzten » der Bruderschaften selbst, um diese zu korrumpieren und für die Interessen der Kolonialverwaltung zu gewinnen.
Der Kolonialismus feiert sich selbst
Während auf der algerischen Seite der Muezzin zu einem neuen Aufbruch rief, wähnte sich der Kolonialismus in seiner längst verschiedenen Blütezeit, die er mit den pompösen Festivitäten zum Einhundertjährigen 1930 nochmals heraufzubeschwören versuchte. Die koloniale Wissenschaft schien weniger darauf angelegt zu sein, die Umwelt und die Gesellschaft zu « erfassen », als mehr sich selbst zu reproduzieren. Je mehr ein algerisches Bewußtsein zu wachsen schien, umso tiefer verharrte sie in verkrusteten und anachronistischen Ergüssen. Gewiß sollte das Repertoire der Rechtfertigungen sich « modernisieren », doch durfte sich unter keinen Umständen etwas an dem Grundprinzip der kolonialen Herrschaft ändern.
Verschanzt in den Beschreibungen der überlebten Sitten und Sozialstrukturen betrieb die Ethnologie eine Folklorisierung, die öfters verbunden war mit dem Lamentieren um die vergangene Epoche, in der die Traditionen noch lebendig waren. Auch in Algerien habe die « moderne » Welt Einzug gehalten und die so romantische Gesellschaft transformiert. Nachdem die koloniale Destrukturierung festgestellt, der Zusammenbruch der kulturellen Rückzugspunkte, des Ursprungsglaubens und der Überlebensstrategien beklagt wurde, schien die Aufgabe der Wissenschaftler darin zu bestehen, das zu retten, was noch zu retten war. Es wurde gesammelt, beobachtet, archiviert, katalogisiert und musealisiert. Mit dieser Zelebrierung der gefährdeten Kulturen setzte die Ethnologie die Arbeit ihrer Vorgängerin fort, da weiterhin der « Primitivismus » und das « Barbarische » des Objektes im Zentrum der Beschäftigung stand. Die Uniformisierung der Vielfältigkeit, die Nivellierung der kulturellen Formen ging weiter voran.30 Der Auftrag der verschiedenen Wissenschaften bestand darin, von der Persönlichkeit des Algeriers Besitz zu nehmen und ihn zur Schau zu stellen. Die großen Feierlichkeiten in Frankreich 1930 waren der Ort für das Präsentieren der zahlreichen Facetten einer ansonsten verachteten Kultur. Die AlgerierInnen sollten dabei einbezogen werden und für diesen Anlaß Kunsthandwerk, Kostüme usw. produzieren und vorführen.
Und immer erweist die Wissenschaft gute Dienste
Die von den Wissenschaftlern erfundene Tradition hatte zum Ziel, die AlgerierInnen in ein – wie Fanon es ausdrückte – mumifiziertes Gebilde einzusperren, an dessen Gestaltung sie am liebsten aktiv partizipieren sollten. Es hatte mit ihrem konkreten Leben wenig zu tun, aber es wurde ihnen vor allem durch die kolonialen Bildungsinstitutionen als wertvolles Gut präsentiert. Die traditionelle Familie, das Bauernleben, der « Volksislam », usw. wurden glorifiziert. Dieser gepflegte Traditionalismus war die Antwort auf den zunehmenden Einfluß, den nationalistische Ideen wie islamische Erneuerungsbewegungen ausübten. Der Diskurs über das verschollene Ideal, war gekoppelt mit einem zweiten Diskurs über das Versprechen, die gleichen Rechte zu erlangen. Der erste richtete sich an die Bauern, für die das Verharren in scheinbar bekannten Strukturen gedacht war, vor allem seitdem sie aus ökonomischen Gründen in die Städte flohen; und der zweite war der aufsteigenden jüngeren Generation zugedacht, die das koloniale Bildungssystem durchlaufen hatte. Indoktriniert mit den Werten der europäischen Zivilisation, durfte sie an dem großen Projekt der Modernisierung und des Fortschrittes teilnehmen. So formulierte ein Kolonialtheoretiker: « Infolgedessen gibt es nicht mehr wie am Anfang in der so verstandenen kolonialen Aktion ‘das Recht des Stärkeren’, sondern ‘das Recht des Starken dem Schwachen zu helfen’, was als das wirklich edelste und höchste Recht erscheint. Die Operation ist nicht mehr einseitig; sie vertreibt nicht einen Besitzer zu Gunsten eines Plünderers; sie kann mit mehr Berechtigung als die vorherige den Titel des ‘Kolonialpakts’ verlangen, weil sie für die beiden, die ein Recht haben und die durch eine Politik der Assoziation verbunden sind, gedacht ist. »31
Zivilisatorische Mission und Rechtfertigungszwang
Der Kolonialismus feiert sich selbst und scheint zur Rechtfertigung immer mehr betonen zu müssen, welche Wohltaten er den « Eingeborenen » gebracht, welche technologischen und geistigen Erneuerungen er eingeführt und welche menschliche Solidarität er gezeigt hat. Das Jahr 1830 sei die Geburtsstunde von etwas neuem, das Algerien heißt, wobei der neue Algerier der Lateiner ist, der das Reich seiner Ahnen wiedergefunden und wieder fruchtbar gemacht hat. Diese Segnungen werden brüderlich mit den « Eingeborenen » geteilt, so wie es die Grundsätze der französischen Revolution vorschreiben. Nun gibt es in der Wahrnehmung der kolonialen Gesellschaft ein « vorher » und ein « nachher »: « Die Eingeborenen könnten sich ohne Hintergedanken an das Gedenken einer Eroberung anschließen, die für sie wohltuend war. Weit davon entfernt in Algerien eine Nation, die es nie gegeben hat, zerstört zu haben, haben wir sie geboren; wir haben die Algerier von der brutalen Herrschaft der Türken und ihrer eigenen Anarchie befreit; wir haben den Kriegen zwischen den Stämmen, den Epidemien, dem Hunger, die sie dezimierten, ein Ende gesetzt. Wir haben uns bemüht, ihre physischen, intellektuellen und ökonomischen Bedingungen zu verbessern… Wenn keine Propaganda unser Jahrhundertwerk hindern kommt und uns das Verdienst entzieht, werden die Eingeborenen, dessen kann man sich sicher sein, Schritt für Schritt sich uns annähern. »32
Reformen und Krieg
Wie wir sehen, schien der koloniale Diskurs einige « Reformen » zu erfahren, indem die Konzeption des « modernisierungsfähigen » Muslim entwickelt wurde. Das alte dichotome Bild, das den positiven Bestrebungen der Moderne den Islam entgegensetzt, ist jedoch weiterhin lebendig. Der « Islam » wird als Konstrukt ausgereift und präzisiert. Er dient weiterhin zum Sinngehalt, in den die gesamte Verachtung, Abscheu und Überlegenheit projiziert werden kann, erfährt aber auch ein zunehmendes akademisches und politisches Interesse. Schon Anfang des Jahrhunderts gab es Tendenzen mehrere Formen des Islam zu unterscheiden, um die möglichen Bündnispartner ausfindig zu machen. Aus den linken Kreisen in Frankreich erhebt sich die Stimme des berühmten sozialistischen Führers Jaurès: « Ihr wißt sehr wohl, daß diese muslimische Welt sich sammelt und sich über ihre Einheit und Würde bewußt wird. Zwei Bewegungen, zwei gegensätzliche Tendenzen streiten sich um sie: da sind die Fanatischen, die mit der Furcht, dem Eisen und Feuer mit der europäischen und christlichen Zivilisation brechen wollen, und es gibt die modernen Menschen, die neuen Menschen… Es gibt eine ganze Elite, die sagt: ‘der Islam wird sich nur retten, indem er sich erneuert, indem er sein altes religiöses Buch, entsprechend eines neuen Geistes der Freiheit, der Brüderlichkeit und des Friedens interpretiert’. Und dieser Elite schwebt es nicht vor, den Rahmen der europäischen Zivilisation und Administration zu zerstören. » Jaurès wendet sich an das Parlament und sagt weiter, bezugnehmend auf die militärische Eroberung Marokkos: « In dieser Zeit, wo sich diese Bewegung abzeichnet, liefern Sie den Fanatikern des Islam die Begründung, die Gelegenheit zu sagen: ‘wie soll man sich mit diesem brutalen Europa versöhnen? Hier ist Frankreich, das Frankreich der Gerechtigkeit und der Freiheit, das keine anderen Gesten gegenüber Marokko hat, als Bomben, Kanonen und Gewehre!' »33 Hier wird deutlich, daß nicht das kolonialistische Projekt an sich im Kreuzfeuer steht, sondern die Methoden der Durchsetzung. Eine Art humanistischer Kolonialpakt mit sozialistischem Einschlag wird gepriesen, der die benachteiligten Gesellschaften an der Modernisierung teilhaben läßt. Dafür ist es nötig, sich auf eine einheimische bürgerliche Schicht stützen zu können, nämlich die, die einen tolerierbaren Islam vertritt, der den Werten der französischen Revolution entspricht. Ein Islam, dem seine lebendige Kraft und historische Dynamik entzogen wurde und der zu einer Ansammlung von ungefährlichen religiösen Praktiken verkommen ist. Doch die Warnungen vor diesem gewalttätigen und fanatischen Islam bleiben weiterhin dominant und erfahren umso mehr Nachdruck mit dem Erstarken der Befreiungsbewegung. In einem Bericht des Algerienministerium von 1957 kann man zu den Befreiungskämpfern lesen: « man verbrennt, man zerstört, man raubt alles, was dem Europäer gehört, der von dem Moudjahid, dem Kämpfer des Heiligen Krieges, als ein Ungläubiger angesehen wird. »34
1954 und der Weg zur Unabhängigkeit
Die großen Feiern von 1930 waren natürlich für viele Algerier ein Schlag ins Gesicht. Ihnen wurde die geballte Arroganz eines sich im Sieg wähnenden Geschwürs vor Augen gehalten. Die Versuche, auf legaler Ebene mehr Rechte zu erringen, waren gescheitert, sollten aber noch einige Energien verbrauchen. Wie sollte die Kolonialmacht auch Reformen zulassen, ohne sich das eigene Grab zu schaufeln? Also machte sie sich daran, ihre Herrschaft zu konsolidieren, was natürlich die Demütigung der AlgerierInnen nur steigerte.
Widerstand auf dem Höhepunkt des Kolonialismus
Schon Anfang des Jahrhunderts war es einer kleinen algerischen Elite in den Städten gelungen, sich bei manchen Liberalen Gehör zu verschaffen. Die « jungen Algerier » wollten die politische Gleichberechtigung mit den Franzosen Algeriens, also eine Assimilation, die aber auch die Abschaffung vieler Ungerechtigkeiten bedeutet hätte: das Recht auf Schulbildung, das Ende der diskriminierenden Steueraufteilung, eine größere politische Repräsentation der « Muslime », usw… wurden gefordert. Doch selbst diese verhältnismäßig harmlosen Forderungen wurden von der Kolonialverwaltung als « nationale Bewegung gegen die französische Besatzung » verstanden und bekämpft. Herausragende Figur dieser Bewegung der « jungen Algerier » ist Emir Khaled, der Enkel des Emir Abd-El-Kader, der schließlich ins Exil gehen mußte.35
Mit immer größerem Interesse wurde der Ruf des kämpferischen Islam und des politischen Nationalismus aufgenommen. Die Partei von Messali Hadj entwickelt unter den Emigranten in Frankreich größere Aktivitäten und erhält mit ihrem Presseorgan immer mehr Gehör und Zulauf. Die Ausrichtung ist sozialistisch, antiimperialistisch und nationalistisch, die algerische Kultur mit ihren zwei Hauptelementen, den Islam und die arabische Sprache, wird der kolonialen Kultur entgegengesetzt. Schritt für Schritt faßt diese Bewegung auch in Algerien Fuß und verfügt über ein Netz von Aktivisten.
1931 wurde die Assoziation der Ulemas (islamische Rechtsgelehrte) gegründet, die schon in den Jahren zuvor in ihrem Presseorgan begonnen hatte, sich für die Wiederbelebung des Islam einzusetzen. Sie wandte sich ausdrücklich gegen die Assimilationspolitik und obwohl sie sich loyal gegenüber Frankreich zeigte, trug sie sehr stark dazu bei, daß das Bewußtsein über die Existenz einer islamischen Gemeinschaft, die sich über die Grenzen Algeriens erstreckt, wachgerufen wurde. Mit ihren Schulen, Zirkeln, Sportvereinen, Zeitungen und Moscheen sollten die Ulemas sich stark in der Bevölkerung verankern und eine tiefe erzieherische Arbeit leisten, die das Bewußtsein vieler Aktivisten der zukünftigen FLN prägen wird. Sie richteten ihren Kampf gegen die algerischen « Assimilationisten », den Maraboutismus, der in ihren Augen mit der französischen Administration kollaborierte und den offiziellen islamischen « Klerus ». Trotzt der Repression, die aus Versammlungs- und Presseverbot, Schließung ihrer Moscheen und Schulen bestand, konnten die Reformisten nach 1946 umso größere Aktivitäten entfalten, vor allem im Bereich der Schulbildung, und wandten sich eindeutig den nationalistischen Parteien zu. In den Augen vieler Franzosen waren sie nur Fanatiker des Islam, die sich gegen den Fortschritt und die Moderne verschließen: « Die (reformistischen) Theoretiker wollen zum primitiven Glauben der finsteren und ungebildeten Kameltreiber, der Gefährten des Propheten zurückkehren. »36
Der Kolonialstaat sah sich selbst als Garant der islamischen Orthodoxie und die Reformisten erschienen als Häretiker, die vom Fanatismus und der Xenophobie bewegt seien.37 Messali Hadj seinerseits war in der offiziellen Propaganda ein « Hausierer », dessen Anhänger nur darauf warteten, daß er ihnen den Befehl erteilte, « den erstbesten Passanten die Kehle durchzuschneiden. »38 Das Bild des fanatischen Muslim erfüllt weiterhin seinen Zweck, und erfährt sogar eine Erweiterung der Terminologie und des Verständnisses: Je mehr sich die Algerier vertrauter Formen der Organisation und Artikulation bedienen, umso mehr gesellen sich zu ihrer Charakterisierung die Eigenschaften der Kriminalität, Gewalt und des Terrorismus.
Die Zwischenkriegsphase ist gekennzeichnet durch das Auftreten einer algerischen Mittelschicht,39 die eine Assimilationspolitik befürwortete. Sie forderte Reformen, die die Laizisierung, die Einbürgerung und die « Entwicklung des Eingeborenen, durch die französische Kultur » zum Ziel hatten. Zwar gewährt ihnen die Kolonialverwaltung wenig Gehör, aber weiß die politischen Differenzen in der algerischen Gesellschaft für ihre Zwecke auszunutzen. Sie hält an der Tradition der « ethnischen » Differenz zwischen Berber und Araber fest und praktiziert eine spezielle « Berberpolitik ». Auch zahlreiche Arbeiten der Orientalisten sollen das Gefühl vermitteln, daß eine « berberische Individualität », die dem « lateinischen Okzident näher ist als dem arabisch-islamischen Orient »,40 existiert. Die Missionare förderten diesen Partikularismus, da sie die Islamisierungsarbeit der Reformisten zu bremsen versuchten. Doch es muß betont werden, daß die Bemühungen der Kolonialisten nur sehr begrenzte Wirkungen zeigten. Die nationalistische Bewegung besaß schon eine solche Mobilisationskraft, daß ein solcher Diskurs wenig Früchte trug.
Der bewaffnete Befreiungskampf
Im November 1954 ruft eine kleine Gruppe von bewaffneten Widerstandskämpfern zum Krieg gegen die Kolonialherrschaft auf. Dieser Krieg wird über sieben Jahre lang dauern und die Fratze des Kolonialismus von seiner häßlichsten Seite her offenbaren. Je größer der Widerstand, umso härter wird die Apartheid-Politik durchgefürt: die systematische Trennung der europäischen und algerischen Bevölkerungen, die systematische Vernichtung der AlgerierInnen, die systematische Zerstörung der Umgebung der Einheimischen. Es geht um Leben oder Tod für die eine oder die andere Seite.
Die offizielle Propaganda sieht sich mit einer zunehmenden Wiederaneignung der Geschichte durch die AlgerierInnen konfrontiert. Die vorkoloniale Zeit, die Erinnerung an ehemals glanzvolle Tage, das arabische und islamische Bewußtsein und die Aggression Frankreichs erscheinen in einem neuen Licht der wiedergefundenen Sprache und Identität. Die Ideologen des Kolonialismus schöpfen aus der alten Mottenkiste ihrer Herrschaftslegitimation und aktualisieren längst verstaubte Konzepte: Algerien sei ein menschenleeres Land gewesen. Die wenigen Einwohner, die es gab, hätten vom Kolonialismus profitiert. Wenn die Europäer gingen, würde Algerien wieder ins Mittelalter verfallen.
Die Wissenschaftler im Dienste des Kolonialismus « entdecken » in ihrer Sorge um das Überleben der Partikularismen die « ethnische » und die dörfliche Gemeinschaft. Die idealisierte bäuerliche Einheit des Stammes wird zum strukturellen Modell der muslimischen Gesellschaft erklärt. Doch diesmal geht es nicht um die Folklorisierung der früheren Jahre, sondern um die Erfassung des Widerstandes. Das « algerische Problem » muß transparent werden: Wenn die « Eingeborenen » revoltieren, dann weil das Land unterentwickelt sei. Die Unterentwicklung sei die Ursache für die ökonomischen Probleme, die Landflucht, die galoppierende Bevölkerungszahl, den bäuerlichen Charakter der Gesellschaft, das Festhalten an religiösen Praktiken usw…41 Die Entwicklungskonzeption knüpft an alte Evolutionstheorien: Die Tradition und Rückständigkeit in der die muslimische Gesellschaft verharre, wirke lähmend auf die Erfordernisse des modernen und industriellen Lebens und müsse auch mit Hilfe der muslimischen Elite zerstört werden. Dieser Archaismus könne nur mit Bildung und Erziehung der richtigen Werte ausgerottet werden.
Diese Analyse wird umso wichtiger, da sie in konkreten Maßnahmen umgesetzt wurde. Neben den immer repressiveren Mitteln, um den Befreiungskrieg zu beenden, wie die Errichtung von Internierungslagern, die Durchführung von Umsiedlungsprogrammen und natürlich der militärische Krieg, wird von Evolution und Integration gesprochen. Mit der nötigen Erziehung und Förderung würden längerfristig die AlgerierInnen die selben Rechte erlangen können. Frankreich sieht seine Aufgabe darin, den Untertanen Schutz zu gewähren, indem sie in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Bildungsprogramme, Entwicklungsstrategien und Industrialisierungsvorhaben (Plan de Constantine 1958), vermehrter Zutritt der AlgerierInnen in die Verwaltung, Entschleierungskampagnen für die Algerierinnen, alles Maßnahmen, um Algerien nicht zu verlieren.
Vielleicht doch eine Assoziationspolitik?
Mit zunehmender Verhärtung des Krieges ändern sich bei manchen Politikern die strategischen Überlegungen: Es erscheint viel vorteilhafter, die wirtschaftlichen Interessen mit Hilfe der Assoziationspolitik und der Anbindung an das Mutterland zu bewahren, als den militärischen Krieg weiter zu führen. Die Äußerungen des damaligen Justizministers François Mitterrand 1957 sind diesbezüglich eindeutig: « die systematische Ablehnung und die Repression gegenüber den kolonialen Nationalismen birgt die Gefahr des totalen Verschwindens der französischen Präsenz in Übersee. »42 « Ohne Afrika » – schreibt Mitterrand – « wird es im 21. Jahrhundert keine Geschichte Frankreichs mehr geben », und weiter: « Der Rücktritt, die Kapitulation Frankreichs sind nicht das Ergebnis seines Verzichtes auf die Privilegien der Herrschaft, sondern Ergebnis seiner Zögerungen und seiner Ablehnungen gegenüber der notwendigen Umwandlungen einer Welt, in der die koloniale Vormundschaft keinen Platz mehr hat. »43 Nach der Devise « Gehen, um besser zu bleiben » plädieren manche für einen militärischen Rückzug. Selbst die Kirche, die anfangs für ein hartes Durchgreifen war, scheint mit dem Verlauf der Ereignisse mehr auf den Erfolg der jungen Nationalismen zu setzen im Sinne von « Frankreich geht, die Kirche bleibt. »44
Doch in Algerien standen nicht nur die Interessen Frankreichs auf dem Spiel, sondern die Vorherrschaft der kolonialen Gesellschaft. Viele der Pieds Noirs (Bezeichnung für die in Algerien geborenen Europäer) konnten sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, in einem Algerien zu leben, das ihnen nicht mehr die ehemalige Macht verleiht und organisierten sich in einer rassistisch-faschistischen Bewegung, die bis zum bitteren Ende wütete. Nach über sieben Jahren erbitterten Krieges war es der algerischen Nationalbewegung endlich gelungen, Frankreich an den Verhandlungstisch zu bringen, um über die Modalitäten der Unabhängigkeit zu verhandeln.
1962 und die Unabhängigkeit
Algerien war nun formal unabhängig und hatte allen Grund, seinen Sieg zu feiern. Einer der blutigsten antikolonialen Kriege war vorüber und hinterließ ein auf allen Ebenen völlig destrukturiertes Land. Der Kampf um die Unabhängigkeit hatte eine Million Menschenleben gefordert, ein Drittel der Bevölkerung war umgesiedelt und etwa 7000 Dörfer zerstört worden. Die Nationalbewegung machte sich daran ein neuen Staat aufzubauen, der mit seiner sozialistischen Orientierung allen Menschen eine ausreichende Versorgung zu gewähren versprach. Die Entkolonialisierung basierte auf die Übernahme zweier vom Kolonialstaat eingesetzter Modelle: die technische Entwicklung, die vor allem in den letzten zehn Jahren eingeführt worden war, und die Staatsorganisation und Verwaltung. Beide Elemente sollten der ehemaligen Kolonialmacht weiterhin einen gewissen Zugriff erlauben. War erstmal der repressive Charakter Frankreichs verschwunden, konnten andersartige Beziehungen sich aufbauen. « Zwei Faktoren haben zu dieser dauerhaften Verbundenheit wesentlich beigetragen: 1. das Selbstverständnis der französischen Kolonialexpansion als ‘mission civilisatrice’ und die nachhaltige Prägung der einheimischen Eliten durch sie; 2. die Politik der ‘présence française’ nach der Unabhängigkeit, als deren Instrument eine umfassende Entwicklungszusammenarbeit (‘coopération’) diente. »45 Die Franzosen mußten zwar umdenken und ihre Bestimmung als « Mutterland » begraben, doch werden sie nicht so leicht auf ihre Einflußnahme auf das Schicksal Algeriens verzichten können. Nicht allein weil sie der Überzeugung sind, daß die technischen und zivilisatorischen Errungenschaften im Lande ihr Werk sind und sie den geistigen Besitzanspruch darauf erheben, sondern auch weil Algerien ihr natürlicher Hinterhof bleiben soll. Sie hatten einige Vorbereitungen getroffen, um das zukünftige Gerüst des Staatsapparates derart zu gestalten, daß im Rahmen der Evian-Verträge die « coopération » in neue Abhängigkeitsbeziehungen bruchlos übergehen würde. Sie sollten z.B. noch fast zehn Jahre lang den Besitz der Erdölfelder bewahren, ein entscheidendes Element der bilateralen Beziehungen. Auch war und ist Frankreich immer noch wichtigster Importpartner, was die Abhängigkeit gerade der letzten Jahre nur verschärft. Die Beziehungen sind aufgrund der kolonialen Vergangenheit und der Neigung, einen gewissen Paternalismus zur Schau zu stellen, immer heikel, doch kann Frankreich sich auch seiner Einwirkung, vor allem auf der kulturellen Ebene, sicher sein.
Der gesamte koloniale Verwaltungsapparat, das Rechtssystem und Schulsystem und natürlich die staatlichen Betriebe wurden mit den noch unter der Kolonialherrschaft ausgebildeten Angestellten übernommen. Da sehr viele Franzosen das Land verlassen hatten, mußten AlgerierInnen ausgebildet werden. Wer übernahm diese Aufgabe? Natürlich Frankreich, entweder indem « Experten » nach Algerien geschickt wurden oder AlgerierInnen zur Aus- und Fortbildung nach Frankreich gingen. Mit dem Zauberwort der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit sicherte sich Frankreich – vor allem über die Vermittlung des Wertesystems – einen immensen Einfluß in bestimmten Schichten der algerischen Gesellschaft. Dabei spielte auch die Migration eine große Rolle.
Der koloniale Diskurs lebt weiter
Begriffe wie Laizität, Demokratie, Menschenrechte, Individualismus und Gleichheit dienten weiterhin zur Abgrenzung gegenüber einer Weltanschauung, die als die Negation der Freiheit dargestellt wird, weil sie auf islamischen Grundsätzen basiert. Das alte koloniale Muster bleibt bestehen: Zivilisation kann nur das Modell des europäischen Nationalstaates sein, allen voran des laizistischen Staates in Frankreich. Etiketten werden verteilt: diejenigen, die sich für ihn aussprechen sind progressiv, die anderen sind Reaktionäre. Ein entscheidendes Vehikel für diese zivilisatorische Konfrontation ist die Sprache. Indem Französisch als eine der Moderne angepaßte Sprache im Gegensatz zum Arabischen erschien und auch in der Praxis des jungen algerischen Staates ihre AnhängerInnen fand (der ideologische Diskurs vermittelt allerdings etwas anderes), wurden die Debatten über die angemessene Sprachenpolitik instrumentalisiert in einem Konflikt, der viel tiefere Wurzeln hatte.
Die neuen Eliten Algeriens entschieden sich für ein Entwicklungsprojekt mit sozialistischer Tönung, das zugleich den Anspruch hatte, die gesellschaftlichen Werte zu modernisieren, d.h. zu okzidentalisieren. Demgegenüber standen immer Kräfte, die nicht unbedingt gegen eine Industrialisierung des Landes waren, aber sich für eine algerische Persönlichkeit einsetzten, die sich aus der arabischen und islamischen Tradition entwickeln sollte. Diese Strömung hatte auch ihre Repräsentanten in der damaligen Einheitspartei FLN, ähnlich wie die « Verwestlichungs »-Befürworter. Harte Auseinandersetzungen wurden ausgetragen in Bezug auf die Sprachenpolitik, den Stellenwert der Religion in der Gesellschaft, den Privatbesitz, das Familienrecht, doch verbargen sich dahinter grundsätzlich unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe.
Das alte dichotome Bild über die algerische Gesellschaft, das die Moderne der Tradition gegenüberstellt, ist niemals überwunden worden, im Gegenteil, es hat in der nachkolonialen Epoche seinen Widerhall gefunden und sich in manchen Geistern noch tiefer verankert. Alle Versuche die Veränderungen als eine soziale Dynamik der Transformation und der Entwicklung darzustellen, konnten nicht darüber hinwegtäuschen, daß die kolonialen Strukturen weiter am Werk waren, auch wenn sie « algerianisiert » wurden. Ein Modell wurde den aufsteigenden Generationen geboten, das, solange der algerische Staat von seiner revolutionären Legitimation und seiner ideologischen Abgrenzung vom Westen zehren konnte, toleriert wurde. Die sozialistische Option hatte zwar zum Ziel, einen vom Westen unabhängigen politischen und kulturellen Weg zu beschreiten, doch ohne fundamentale strukturelle Innovationen in den internationalen Beziehungen und die Ausarbeitung geeigneter Modelle, die die spezifischen historischen und soziokulturellen Bedingungen berücksichtigen, konnte nur die relative Abhängigkeit von den Industriestaaten weiter reproduziert werden. Je deutlicher wurde, daß der Modernisierungskurs auf einen Ausverkauf des Landes und eine kulturelle Entfremdung hinauslief, desto stärker entwickelten sich alternative Bezugssysteme.
1988 und die Revolte der « Verdammten »
Solange die Einnahmen aus dem Erdöl- und Gasexport so hoch waren, daß die Verteilung nach unten einigermaßen gewährt werden konnte und für die meisten Menschen eine Verbesserung ihrer Existenzgrundlage – allen voran die Gesundheitsversorgung und die Bildung – erkennbar blieb, waren die von der Zentralmacht überwachten Oppositionsbewegungen (marxistischer oder islamischer Tendenz) fast nur im universitären Bereich aktiv. Mit dem massiven Preisverfall des Öls, die für Algerien wichtigste Devisenquelle und der Zunahme der Schulden kam der prekäre gesellschaftliche Konsens ins Wanken. Während der Staat immer weniger seinen sozialen Engagements nachkam, wie Wohnungsbau, Wasserversorgung und Arbeitsplatzbeschaffungen, konnte eine aus seinem Räderwerk entwickelte Bourgeoisie sich immer weiter bereichern und diesen Reichtum, der einen westlichen Lebensstil verkörpert, zur Schau stellen. Der Unmut in der Bevölkerung hatte sich schon in den Jahren zuvor in Aufständen manifestiert (« Berber-Aufstand » 1980, 1986 in Constantine…), und im Vorfeld der Revolte von 1988 hatten Streiks und Arbeitsniederlegungen das Terrain vorbereitet. Die vorgesehene Austeritätspolitik mit der Suspendierung der Subventionen für manche Grundnahrungsmittel, den Rationalisierungen in den Großbetrieben, Importbeschränkungen usw. konnte nur noch größeres Leid für die Menschen bedeuten. Der Protest erhielt ein solches Ausmaß, daß im Oktober 1988 die meisten Großstädte in Aufruhr waren. Die vorwiegend jungen Demonstranten richteten ihre Wut auf alle Symbole des Staates, der Partei und des Reichtums. Zum ersten Mal hatte die algerische Armee auf Demonstranten geschossen und dabei an die tausend Tote verursacht. Die Krise war nun so zugespitzt, daß nur eine « Demokratisierung » als Ausweg möglich schien. Die FLN sollte nicht mehr als einzige Partei die AlgerierInnen repräsentieren; Meinungsvielfalt, Pluralismus und Wahlen waren die Schlagwörter der Stunde. Auf der ökonomischen Ebene war die Rede von Marktwirtschaft, ohne in einen wilden Kapitalismus verfallen zu wollen.
Zivilisation contra Islam?
Für den Westen allen voran viele Franzosen, waren die Unruhen bedrohlich, da sie aufgrund der starken Migration Folgen im eigenen Land befürchten ließen. Die Analyse der Situation verläuft immer nach einem beliebten Schema, das in vielen Zügen das alte koloniale reproduziert: Die Unterentwicklung habe sich mit einer « Bevölkerungsexplosion » nur noch weiter verschärft, hinzu komme die Korruption und der Klientelismus, typische Elemente einer nicht überwundenen tribalen Gesellschaftsstruktur, die keine Demokratie zulasse. Das algerische « Problem » wird auf die drei Krisen reduziert: die ökonomische, die in allen « Entwicklungsländern », die einen sozialistischen Kurs wählten, zu verzeichnen sei; die politische, die das Regime der Einheitspartei und der daraus folgenden mangelnden Freiheit mit sich brächte und schließlich die moralische, da die islamisch geprägten Mentalitäten sich nicht der modernen Welt anpassen, den Frauen keine Entfaltungsmöglichkeiten und Rechte zusprechen, die Sexualität tabuisieren würden, usw. Die jungen Leute seien zwischen individualistischen Bedürfnissen und religiösen Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft hin und her gerissen.
Als schließlich die FIS (islamische Rettungsfront) als Partei ein paar Monate später in Erscheinung trat und immer größeren Zulauf bekam, konnten die entfesselten Stimmen « Oh Fanatismus, oh Barbarei » schreien. Das alte Bild des dummen, archaischen und gewaltätigen Muslim bzw. in seiner aktuellen Bezeichnung « Fundamentalist » und « Integrist » war wieder salonfähig. Ganz schnell beherrschte die frühere Polarisierung die Wahrnehmung der Ereignisse in Algerien: Auf der einen Seite die freiheitsstrebenden, rationalen und Menschenrechtsbefürwortenden Demokraten, auf der anderen Seite diejenigen, die die Negation all dieser Werte repräsentieren, die man schon zu Universalien erhoben hatte. Was in Algerien vor sich ging, schien die Konfrontation zwischen zwei Wertesystemen zu sein, die aus westlicher Sicht den Charakter der Verlängerung des Krieges zwischen zwei Zivilisationen erhielt. Die internationalen Geschehnisse sollten diesen Eindruck nur bekräftigen: Überall in der islamischen Welt erstarken die islamischen Bewegungen, die den Alleinanspruch der okzidentalen Welt merklich bedrohen, der Irak-Krieg, der im Geiste eines Kreuzzuges geführt wurde, der Bosnien-Krieg als ein Genozid an den Muslimen und als Sieg der europäisch-christlichen Zivilisation in Europa, usw…
Garant der westlichen Kultur und Interessen war dann auch in den Augen der europäischen Regierungen der algerische Staat. Der Abbruch der Wahl im Januar 1992, die für die FIS einen sicheren Sieg bedeutet hätte, löste zwar ein gewisses Unbehagen in den europäischen Metropolen aus, weil der Coup zu offensichtlich war, doch konnte sich die algerische Regierung der Unterstützung sicher sein. Gewiß mußten da noch einige Ungereimtheiten in Bezug auf die Wirtschaftspolitik aus dem Weg geräumt werden, aber der Kniefall vor dem IWF garantierte die Glaubwürdigkeit der algerischen Option. Im Lande selbst spitzte sich nach dem Abbruch der Wahl und dem Ausruf des « totalen Krieges » seitens des ehemaligen Ministerpräsidenten die Lage zu.
Kontinuitäten
Nach Verbündeten suchend trifft die westliche Öffentlichkeit auf die sogenannte demokratische Bewegung. Vor allem die Laizisten werden hier als Repräsentanten des toleranten und humanistischen Algeriens vorgeführt. Neuerdings gesellen sich zu ihnen in den hiesigen Darstellungen die Berber. Diese Tendenz, die alte rassistische Unterscheidung zwischen Berber und Araber wachzurufen, die hier den Eindruck vermitteln soll, alle Berber seien eingefleischte Demokraten und damit der westlichen Weltanschauung viel näher als die vom islamistischen Diskurs erfaßten Araber, ist sehr gefährlich. Leider gibt es auch in Algerien Personen, die gerne die konkreten Forderungen der Kabylen machtpolitisch instrumentalisieren. Zu unrecht wird die Kabylei zur « Islamisten-freien » Region erklärt, und die jüngste Entwicklung, der Regierung im Kampf gegen die bewaffneten Gruppen mit eigenen Trupps beizustehen, macht deutlich, daß die von manchen Politikern zur Schau gestellte Opposition sich leicht in eine Kollaboration umkehren kann. Der Ruf mancher AlgerierInnen nach dem Westen und allen voran Frankreich und der Vergleich mit der Résistance gegen den Faschismus wird hier gerne aufgenommen und in der allgemeinen antiislamischen Propaganda als Beispiel des Kampfes gegen die Unfreiheit vorgestellt.
Der Kriegszug Frankreichs gegen die islamische Bewegung hat sich soweit gesteigert, daß der ehemalige Innenminister Pasqua sich nicht scheut, einige Repressionspraktiken aus der Zeit des Befreiungskrieges wieder einzuführen. Gesichtskontrollen auf den Straßen Frankreichs, unbegründete Festnahmen und Deportationen sowie das Verbot des Kopftuches in Schulen sind einige der Merkmale eines Krieges, den die französische Regierung im eigenen Land aufgenommen zu haben scheint. Das Schweigen über die willkürlichen Erschießungen auf den Straßen, den Bombardierungen der Maquis (militärische Stützpunkte der bewaffneten Gruppen in den Bergen) und den Einsatz von Napalm mit gleichzeitiger Finanzspritze für den Staat ist ein Signal für die bedingungslose Unterstützung der algerischen Regierung durch Frankreich.
Auch hier in Deutschland erfährt die antiislamische Propaganda in den letzten Jahren wieder neuen Aufschwung. Neben der Fülle an Erfahrungsromanen, die vor allem den sexistischen und frauenfeindlichen Charakter der islamischen Gesellschaft betonen, wird der Markt mit populärwissenschaftlichen Büchern überschwemmt, die allesamt den Zweck verfolgen, dem islamischen « Fundamentalismus » auf die Spur zu kommen und jede Erscheinung, die den « heiligen » Werten des Humanismus und der Demokratie nicht entsprechen, buchstäblich zu verteufeln.46 Gewiß sei nicht der Islam im Kreuzfeuer und der Muslim und die Muslimin könnten ohne weiteres ihre Religion ausüben, doch bitte sich nicht der großen erzieherischen Unternehmung wiedersetzen, die sie zu « Euro-Muslimen »47 avancieren läßt. Diese heuchlerische Haltung der Multikulturalisten täuscht nicht darüber hinweg, daß für viele der nächste Krieg schon vorbereitet wird. Deutlich klingen die Worte des französischen Erziehungsministers, der voraussagt: « Der Kampf gegen das islamische Kopftuch dient der Vorbereitung zukünftiger Schlachten, die des nächsten Jahrhunderts, die dem Bereich des Spirituellen angehören », oder folgende Aussage, auch eines französischen Politikers: « Das einzige Baumaterial, über das das Haus Europa verfügt, um sich zu vollenden, ist seine Gemeinschaft der Kultur, der Zivilisation und der christlichen Religion. »
1 Maroons (englisch) stammt aus dem spanischen cimarroes und ist die Bezeichnung für die in den angelsächsischen Kolonien Amerikas entlaufenen Sklaven.
2 Mostefa Lacheraf, l’Algérie: nation et société, 1965, 220
3 Über die Gründe der Eroberung Algeriens siehe u.a. Y.Lacoste, A. Nouschi, A. Prenant, L’Algérie, passé et présent, 1959, 233ff.
4 Chalmin, L’officier français de 1915 à 1970, zitiert in Lacheraf, 255f.
5 Es wird eine Zahl von etwa 100 000 Toten unter den französischen Soldaten angeführt, die während des Eroberungskrieges starben, in Wadi Bouzar, La mouvance et la pause, Algier 1983, 192.
6 Lacheraf spricht von einer Bevölkerung von 5 bis 6 Millionen vor der Kolonisierung und der Vernichtung von mehreren Millionen, s.o., 221.
7 Raoul Girardet, L’Idée coloniale en France, 1871-1962, 1972, 35 ff.
8 Wadi Bouzar, 250f.
9 Lacheraf, 213. Bugeaud war Marschall und organisierte die Eroberung Algeriens (1840-1847). Die Trappisten sind Mitglieder eines 1140 gegründeten Ordens und waren als erste Missionare in Algerien tätig.
10 1841 betrug die europäische Bevölkerung 27 204, 1850 erreichte sie 112 607 Personen. Sie bestand aus 55% bzw. 48% Ausländern: Spanier, Italiener, Anglo-Maltesen. Lacoste, Nouschi, Prenant, 359.
11 Charvet, notes sur l’Algérie par un Algérien, 1892, zitiert in Jean-François Guilhaume, Les mythes fondateurs de l’Algérie française, 1992, 78.
12 Veuillot, Les Français en Algérie, souvenir d’un voyage fait en 1841, 1862, zitiert in Guilhaume, 83.
13 Marnia Lazreg, The Eloquence of Silence, Algerian Women in Question, New York, London 1994, 48ff.
14 Daumas und Fabar, La Grande Kabylie, études historiques, 1848, zitiert in Guilhaume, 93.
15 Mahfoud Kaddache zitiert in Histoire du nationalisme algérien, 1980, aus der Zeitung « L’écho d’Alger » vom 31.10 1924, die die Aussprüche des Senators Gasser wiedergibt, 53.
16 Jean-Paul Charnay, La vie musulmane en Algérie d’après la jurisprudence du XXème siècle, 1965, 302.
17 Camille Sabatier in Lazreg, 49.
18 Hugonnet, Souvenirs d’un chef de bureau arabe, 1858 in Jeacques Frémeaux, Les bureaux arabes, 1993, 244.
19 M. Violette, L’Algérie vivra-t-elle?, 1931 in Lucas, Vatin, 205.
20 A. Servier, L’Islam et la Psychologie du Musulman, 1923, zitiert in Lucas, Vatin, 155-156.
21 Les arabes et la colonisation en Algérie, 1873, zitiert in Guilhaume, 163.
22 Godefroi de Bouillon war einer der Führer des ersten Kreuzzuges nach Palästina. Er gründete das Reich von Jerusalem und regierte es bis 1100. Louis VII war König von Frankreich (1137-1180) und nahm an dem Kreuzzug 1147-49 teil. Saint Louis war König von Frankreich von 1226 bis 1270. Er nahm an mehreren Kreuzzügen teil, u.a. 1270 nach Tunis, um von da aus Ägypten zu bekämpfen, starb aber kaum in Tunis angekommen.
23 Poujoulat, Voyage en Algérie, zitiert in Lacheraf, 51-52.
24 Idem.
25 « Fast alle Araber können lesen und schreiben. In jedem Dorf gibt es zwei Schulen… » General Valazé, 1834, zitiert in Lacheraf, 188.
26 Als Beispiel sei Médéa genannt, eine Stadt, die vor der Kolonialisierung fünf große Moscheen für ca 5000 Einwohner zählte. An diese Moscheen waren viele Schulen angeschlossen. 1849 haben die Franzosen vier Moscheen besetzt und nur eine Schule blieb erhalten. Die Bevölkerung war um die Hälfte zurückgegangen. Siehe Frémeaux, 193f.
27 Leutnant Laquière, zitiert in Frémeaux, 198.
28 zitiert in Frémeaux, 203.
29 in Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, 1983, 68. Er führt auch die Zahl der algerischen Kinder, die französischen Schulen besuchten und 1890 1,9% der im Schulalter befindlichen AlgerierInnen betrug.
30 siehe Lucas, Vatin, 50ff
31 Sarraut, Grandeurs et servitudes coloniales, 1931, in Girardet, 130.
32 A. Bernard, L’Algérie, 1930, zitiert in Girardet, 312.
33 1908, zitiert in Girardet, 109.
34 Guilhaume, 160.
35 siehe Kaddache, 97-126.
36 J. Menaut in L’Afrique française, 1935, zitiert in Ali Merad, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, 219.
37 Merad, 427.
38 L’ami du peuple, 1934, zitiert von Benjamin Stora, Messali Hadj, Alger, 1991, 119.
39 Sie besteht aus Angestellten der Verwaltung, der Justiz, Lehrer, Ärzte, Söhne von Marabouts, die von den Kolonialherren bevorzugt wurden… Was diese Mittelschicht kennzeichnet war die Frankophonie, im Gegensatz zu einer traditionellen Mittelschicht, die aus alten Notabeln, Ulemas, alteingesessene Händler…, die der kolonialen Verwaltung sehr feindlich gegenüber gesonnen war und eher arabophone sind. Natürlich sind die Grenzen zwischen diesen Gruppen fließend.
40 Merad, 357.
41 Auch zu dieser Zeit erscheinen zahlreiche Schriften, die die kriminelle, gewaltätige, faule und schwachsinnige Natur des Algeriers biologisch zu begründen versuchen. Siehe Frantz Fanon, die Verdammten dieser Erde, 1981, 245ff.
42 Girardet, 226.
43 Mitterrand, Présence française et abandon, zitiert in Girardet, 227.
44 Girardet, 268.
45 J.J. Clam: Frankreichs Maghreb-Politik, 152.
46 Siehe Irmgard Pinn / Marlies Wehner, EuroPhantasien, Die islamische Frau aus westlicher Sicht, Duisburg 1995.
47 Bassam Tibi, « Bedroht uns der Islam », Der Spiegel, 5/1993.