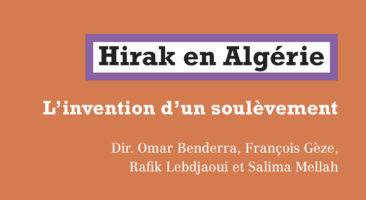Algeriens Militärdemokratur
Salima Mellah, Silsila 6/7 (1997)
In Algerien herrscht Krieg. Ein Krieg, der nicht durch die dichten Mauern der allgegenwärtigen Informationskontrollen dringt. Nur Splitterfragmente werden gezielt gestreut und fügen sich zu einem monomedialen Stück: Bombenattentate, Morde an „Intellektuellen“, Journalisten, Frauen und die Zerstörung der Infrastruktur beuteln dieses Land, das nur danach strebt, endlich demokratisch und frei zu sein, doch von einer Handvoll „Terroristen“ daran gehindert wird; diese „fanatischen Gotteskämpfer“ hätten beinahe auf demokratischem Wege mit den Wahlen von 1991 die Macht übernommen, wären nicht eine Clique von Generälen und ihre aufgeklärten Helfer eingeschritten, um den Wahlprozeß zu beenden und seitdem dafür zu sorgen, daß der Weg für ein wirklich freies Algerien geebnet wird.
Die ersten freien Parlamentswahlen waren nach dem ersten Wahlgang im Dezember 1991 abgebrochen worden, weil zu erwarten war, daß die FIS (Front Islamique du Salut) mit dem vorgesehenen zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit der Sitze erhalten würde. Das Militär schritt ein, setzte den Präsidenten Chadli Bendjedid ab, löste das Parlament auf und ließ kurz darauf den Ausnahmezustand ausrufen. Die Verfassung wurde außer Kraft gesetzt, die FIS aufgelöst, ein Anti-Terrorismus-Gesetz erlassen, das bis heute als Richtlinie dient. Die Opposition wurde massiv verfolgt, Tausende verschwanden in Lagern und Gefängnissen; und bewaffnete Widerstandsgruppen entstanden.1
Ein Krieg ohne Bilder
Abstrakte Zahlen, ungeheuerlich hohe Zahlen von Toten werden uns Monat für Monat präsentiert, ohne daß wir eine Vorstellung dessen hätten, wie sie verursacht werden. 50 000 oder 70 000 Tote in 4 Jahren, wer weiß wie viele Verletzte, Verstümmelte, Verschwundene, Gefolterte… Die einzigen Bilder, die wir sehen, die einzigen Stimmen, die wir hören, werden selektiv und wohlüberlegt zur Schau gestellt. Wir sehen keine Bilder von Massenhinrichtungen, bombardierten Dörfern, Massengräbern, Lagern in der Wüste oder von Folter gezeichneten Körpern. Die Informationssperre ist vom algerischen Regime auferlegt worden, und kein nennenswerter Protest erhebt sich dagegen, auch nicht im Ausland. Die algerischen Journalisten werden seit der Ausrufung des „totalen Krieges“ von geheimen „Empfehlungen“ und „Rundschreiben“ des Innenministeriums auf „Linie“ gezwungen, indem sie bezüglich der „Sicherheitslage“ und heiklen Themen wie Korruption ausschließlich die von der staatlichen Presseagentur APS herausgegebenen Meldungen verarbeiten dürfen und fast ausschließlich eine propagandistische Rolle zu erfüllen haben.2 Die Strafe bei „Befehlsverweigerung“ ist hoch. Sie kann von einer Suspendierung der Zeitung bis zur Liquidierung gehen.3 Ausländischen Korrespondenten wird nur noch selten ein Visum erteilt, und die meisten ausländischen Pressebüros sind geschlossen worden. Doch viel nachdenklicher stimmt die Gleichschaltung der Berichterstattung von Kreisen, die keine Verfolgung zu befürchten haben und in die Kriegspropaganda einstimmen. Es ist der mutigen Arbeit von wenigen Organisationen und Journalisten (übrigens auch in Algerien) zu verdanken, daß immer mehr Berichte über die systematische Ausschaltung von „mutmaßlichen“ Oppositionellen und die Terrorakte der Sicherheitskräfte verbreitet werden.4
Desinformation und Gleichschaltung
Seit dem Abbruch der Wahlen und der Verfolgung einer Opposition, die ausschließlich als eine islamistische dargestellt wird, treiben das Regime und die „Demokraten“ eine Informationspolitik, die zur Zuspitzung des Krieges beiträgt. Der Konflikt wird auf das Problem des „Terrorismus“ reduziert, ungeachtet der politischen und sozioökonomischen Dimensionen. Die bewaffneten Gruppen, die das Regime militärisch bekämpfen, werden systematisch mit der FIS identifiziert, um diese in den Augen der Bevölkerung zu diskreditieren. Zudem wird versucht, die gesamte Opposition, die gegen den Abbruch der Wahlen protestierte und für die Aufhebung des Verbots der FIS sich einsetzt, zu isolieren, indem sie des „Verrates an der Nation“ bezichtigt wird. Dieses Unternehmen geschieht in einer Art Arbeitsteilung zwischen den Generälen und einer radikalen antiislamistischen Strömung, die gemeinhin die „Éradicateurs“ (Ausmerzer) genannt wird: Die zivile Seite kämpft an der medialen Front. Sie prangert ausschließlich die „Gewalt der Terroristen“ an und stilisiert sich selbst zum Opfer der „faschistischen Barbarei“, um in einem Aufruf zur „Résistance“ die Solidarität einer „progressiven“ Öffentlichkeit zu erheischen. Daß diese VorkämpferInnen von Freiheit und Moderne eine militärische Lösung befürworten, den Einsatz von Milizen und den Aufbau von Bürgerwehren fordern und bereit sind, das Land in einen Bürgerkrieg zu stürzen, wird im Westen wenig Aufmerksamkeit geschenkt.5 Die schmutzige Arbeit übernehmen Armee, Sondereinsatztruppen, Gendarmerie, Polizei, Bürgerwehren, Geheimdienste und … Todesschwadrone. Die algerischen Machthaber werden gleichzeitig nicht müde, seit Jahren die „Dialogbereitschaft“ und die „Versöhnungsversuche“ der nationalen und internationalen Öffentlichkeit zu präsentieren, die immer wieder davon eingefangen wird.
Die Demokratie marschiert voran
Zum Abschluß der „Dialogrunde“ mit den Parteien im Laufe des Herbstes 1993 inszenierten die Generäle eine Nationalkonferenz, von der eine Partei nach der anderen sich zurückzog. Ait-Ahmed, der Vorsitzende der FFS (Front des Forces Socialistes), kommentierte die „Dialogbereitschaft“: „Über die echten Probleme durften wir nicht reden, weil diese die Vorherrschaft des bestehenden Regimes in Frage stellten. Die Militärs hatten einen roten Strich gezogen. Niemand durfte diesen überschreiten.“6 Doch waren diese „Verhandlungen“ notwendig, angesichts des Drucks von außen, nach dem Militärputsch einen „Ausgleich“ zu erzielen. So begnügten sich die westlichen Regierungen mit dem Ergebnis der „Konferenz“, nämlich der Ernennung von Liamine Zeroual zum Interimspräsidenten, der von nun an als Hoffnungsträger für den Frieden lanciert wurde. Die im Herbst 1994 aufgenommenen, vorgeblich „ernsten“ Verhandlungen mit den zwei gefangenen Führern der FIS, Abassi Madani und Ali Benhadj, wurden als gescheitert erklärt und dienten als Auftakt für eine militärische Großoffensive. Die drei wichtigsten Oppositionsparteien, FLN (Front de Libération Nationale), FFS und FIS, die zusammen etwa 80% der Stimmen im ersten Wahlgang 1991 erhalten hatten, trafen sich im November 1994 und Januar 1995 zusammen mit kleineren Parteien in Rom und erarbeiteten eine „Plattform für eine friedliche und politische Lösung der algerischen Krise“7, die den Weg ebnen sollte für die Beendigung der Gewalt und die Rückkehr zu einem demokratischen Prozeß. Die algerische Führung lehnte diesen Vorschlag kategorisch ab und kündigte kurz darauf Präsidentschaftswahlen für Ende des Jahres an.
Die meisten Oppositionsparteien kritisierten diesen Schritt, da weder die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt waren, noch erkennbar war, daß den Oppositionsparteien die nötige Bewegungsfreiheit gewährt würde. Wie sollten unter Ausnahmezustand und Krieg „freie Wahlen“ stattfinden können? Die UnterzeichnerInnen der Plattform riefen daher zum Boykott der Präsidentschaftswahlen auf.
Die herrschende Militärclique sah sich aus diversen Gründen genötigt, dem Regime einen demokratischen Anstrich zu verleihen. Die größten Oppositionsparteien waren zu einer Einigung gekommen und drohten nun, den Willen zur Veränderung an der Basis zu kanalisieren. Zudem erhielten sie auch im Ausland zunehmend Gehör. Die Ankündigung von Wahlen bot der Führung eine Atempause, in der sie hinter den Wahlvorbereitungen und den Versprechungen auf Pluralismus den Krieg unbehelligt intensivieren konnte. Schließlich stellten die angekündigten Wahlen den IWF und die Gläubiger in ihrer Forderung nach Demokratisierung zufrieden. Die westlichen Regierungen, an deren Spitze Frankreich, waren zwar geneigt, das Regime zu unterstützen, doch mußten sie die Kritik, einen Militärputsch toleriert zu haben, abwehren und drängten deswegen das algerische Regime zur Wiederherstellung der Gesetzmäßigkeit. Zudem mußte die Staatsführung zeigen, daß sie fähig ist, eine Liberalisierung im Sinne der IWF-Formel durchzuführen.
Der IWF diktiert
Die algerischen Machthaber mußten sich dem Diktat des IWF beugen und stimmten im Frühjahr 1994 einem Strukturanpassungsprogramm zu. Darauf folgten Umschuldungsverträge mit den Clubs von Paris und London über etwa die Hälfte der 30 Mrd. $ Schulden. Die ökonomische Umstrukturierung und die Austeritätspolitik treffen die Bevölkerung mit voller Wucht. Die Arbeitslosigkeit steigt immer weiter an, viele Staatsunternehmen werden geschlossen oder privatisiert, der Dinar erfuhr eine Abwertung von über 50%, fast alle Subventionen wurden gestrichen, die Preise freigegeben, die staatlichen Grundversorgungen abgebaut usw. Die Staatsmacht weiß seit der Revolte von Oktober 1988, welche Reaktionen mit der Durchsetzung einer Liberalisierungspolitik auftreten können, zumal die als Errungenschaften der Revolution definierten Leistungen angegriffen werden. Der Krieg gegen die „Terroristen“ liefert dem Regime die Rechtfertigung für repressive Maßnahmen, die immer mehr den Charakter von Einschüchterungskampagnen und Strafexpeditionen gegen alle Bevölkerungsschichten annehmen. Geflohene Polizisten bestätigen durch ihre Berichte die Existenz des staatlichen Terrorismus. So sollen z.B. Dutzende von Polizisten, die in ihren Vierteln bekannt und beliebt waren, vom militärischen Geheimdienst umgebracht worden sein, „um die Leute zu schockieren und aufzuwiegeln.“8 Der französische Politologe François Burgat schreibt: „Jedes Segment der öffentlichen Meinung wurde wohlüberlegt und planvoll anvisiert, jede soziale, ethnische oder soziokulturelle Mobilisierung desgleichen, um sie von ihrem natürlichen Lauf abzubringen und gegen das islamistische Lager zu instrumentalisieren: die Frauen gewiß, aber gleichermaßen die Studenten, die Liebhaber des Fußballs oder des Rai, die Berber, die moderaten Islamisten usw.“9
Die Verlagerung des Konflikts mit einer legalen Opposition, die die neue Wirtschaftspolitik und den Ausverkauf des Landes an die Ölmultis kritisierte, auf die militärische Auseinandersetzung mit den bewaffneten Gruppen, lenkte von den wirklich fundamentalen Fragen ab. Die störende Opposition, die die Unzufriedenheit auffing, wurde mundtot gemacht und ignoriert, bis auf wenige Fraktionen, aus denen die Machthaber Nutzen ziehen konnten oder die ungefährlich waren. Die Armee, die Anfang 1992 noch „Retterin der Demokratie“ sein sollte, wurde, je mehr sie diesen Krieg nötig hatte, zur „Retterin der Nation“ emporgehoben. Die finanzielle und politische Unterstützung aus dem Ausland, allen voran von der alten Kolonialmacht Frankreich, war ihr in dem „Kampf gegen den Terrorismus“ sicher. Mehr noch, der französische Staat nahm den rassistischen Krieg gegen Nordafrikaner und Muslime im eigenen Land auf; ließ er doch Personen ohne Gerichtsverfahren festsetzen und deportieren, Razzien auf den Straßen organisieren, Schriften verbieten und sogar Liquidierungen vornehmen.10
Die Wahl des Volkes
Ist die Demokratie erst einmal in Marsch gesetzt, so tritt sogleich die Frage der Manipulation auf den Plan: die Macht, der ihr Volk nicht paßt, löst dieses bekanntlich auf und wählt sich ein neues. Die Generäle beschlossen, ein neues Volk zu wählen, das seinerseits einen alten Präsidenten zu wählen hatte. Unliebsame Regungen des Volkes mußten abgefangen, die Boykottgefahr gebannt werden. Dafür wurde monatelang eine riesige Maschinerie zur psychologischen und militärischen Kriegführung eingesetzt. Schließlich fand die Wahl am 16. November 1995 statt, unter der Aufsicht eines Heeres von über 300 000 Soldaten, Polizisten und Milizionären, die schon in den Tagen zuvor ihre Stimme abgegeben hatten, umringt von Panzern und behindert durch zahlreiche Straßensperren. Es stand fest, daß Liamine Zeroual von den vier zugelassenen Kandidaten der Sieger sein würde. Unklarheit bestand eher darüber, ob den Militärs eine solche Wahlmaskerade angesichts des Boykottaufrufes und der Drohungen der GIA11, die Wahlen zu verhindern, überhaupt gelingen würde. Im Vorfeld des Plebiszits durfte die Opposition, die zum Boykott aufgerufen hatte, weder Versammlungen abhalten, noch Appelle veröffentlichen; eine Zeitung, die den Boykott unterstützte, wurde einen Monat lang suspendiert; die tatsächliche Zahl der Wahlberechtigten war nicht bekannt12; M. Nahnah, der Kandidat von Hamas, sprach von Einschüchterung der Staatsbeamten; die Schulen und Märkte waren eine Woche lang geschlossen usw. Nur 102 internationale Wahlbeobachter waren entsandt worden. Bis heute bleiben viele Fragen unbeantwortet, so z.B. ob tatsächlich überall Wahlurnen aufgestellt wurden, oder ob ganze Landstriche ausgeschlossen blieben. Das Regime kann sich mit einem immensen Erfolg brüsten, indem es eine Wahlbeteiligung von 75% angibt und Liamine Zeroual mit 61% der Stimmen eine starke Legitimität verleiht. Es kann sogar behaupten, den islamistischen und demokratischen Strömungen in der Gesellschaft eine Artikulationsmöglichkeit gewährt zu haben, da jede von einem Kandidaten repräsentiert sei. Mahfud Nahnah von der moderaten islamistischen Partei Hamas erhielt 25,4% der Stimmen, Said Sadi vom laizistischen RCD 9,3% und Noureddine Boukrouh von der PRA (Parti du Renouveau Algérien) 3,8%.
Demokratie und Krieg ohne Ende?
Nach der Wahl scheinen die meisten westlichen Regierungen und BeobachterInnen zufrieden zu sein, auch wenn sie weitere Schritte fordern, nämlich die Durchführung von Parlamentswahlen. Zweifel werden ignoriert, so z.B. die Behauptung der FFS und der FIS, die Wahlbeteiligung habe bei 35% gelegen. Die Mehrheit der UnterzeichnerInnen der Plattform von Rom (auch die FIS) erkennen Liamine Zeroual als legitimen Präsidenten an und fordern von ihm, daß er seine neugewonnene Autorität nutzt, um die nötigen Schritte zur Beilegung des Konfliktes zu unternehmen. Ein Forderungskatalog wurde erstellt, der die Freilassung der politischen Gefangenen, unter ihnen die Führung der FIS, die Wiedereingliederung der aus politischen Gründen ausgesperrten Arbeiter und Angestellten, den Zugang der Opposition zu den Medien, die Aufhebung der Zensur und der Verfolgung der Journalisten und die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen verlangt.13
Das Regime scheint gestärkt aus dieser Machtprobe hervorgegangen zu sein und beabsichtigt nun die Verfassung zu „reformieren“, Gespräche mit den Oppositionsparteien (außer der FIS) einzuleiten, um Anfang 1997 Parlamentswahlen durchzuführen. Die zaghaften Verweise der westlichen Regierungen haben sich angesichts der lukrativen Geschäfte im Erdöl- und Gasbereich verflüchtigt und die „Aufforderung ‘die politische Basis zu verbreitern’“ („damit waren Kontakte mit dem dialogwilligen FIS-Flügel gemeint“) sind völlig aufgegeben worden. „Die Verdrängung der FIS von der politischen Bühne Algeriens führen Beobachter auch auf die gewandelte Haltung der USA zurück“, […] seit der „Beteiligung Algeriens am (pro-israelischen) Anti-Terrorgipfel von Charm El-Cheikh“.14 Unterdessen wird der Krieg unvermindert weitergeführt.
1 Vgl. dazu Salima Mellah, „Algerien: nach den Wahlen…“, Silsila, Heft 2/93. Siehe auch in diesem Heft R. Attaf und F. Giudice, „Algerien, Die Große Blaue Furcht“.
2 Das Rundschreiben des algerischen Innenministeriums „An die Verleger und Presseverantwortlichen“ vom 7. Juni 1994 enthält genaueste Vorschriften über das zu benutzende Vokabular, die Vorfälle, die erwähnt oder nicht erwähnt werden dürfen, die Notwendigkeit, die Grausamkeit und Barbarei der Anschläge der „Terroristen“ und die Verbindung zum Sudan und Iran herauszustreichen In: alternatives algériennes 1/95.
3 Reporters Sans Frontières spricht von der Ermordung von Journalisten durch das Regime und zählt 20 Zeitungen, die seit dem Putsch suspendiert wurden, in: Arte, Sondersendung zu den Wahlen in Algerien, 16.11.1995.
4 Nur wenige Berichte dringen nach außen. Das Dossier über Menschenrechtsverletzungen, das in der algerischen Wochenzeitung La Nation erscheinen sollte, führte zu ihrer Beschlagnahmung durch die Regierung. Dieses Dossier erschien in Frankreich in: Le Monde diplomatique, März 1996; und in der deutschen Ausgabe der Le Monde diplomatique, März 1996. Siehe die Berichte von Amnesty International; Reporters Sans Frontières, Le drame algérien, Paris 1995; Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de l’Homme, Livre blanc de la répression en Algérie (1991-1994) und zwei neue Bände erschienen 1996, Plan-les-Ouates (Schweiz) 1995; François Burgat, L’Islamisme en face, Paris 1995, insbesondere das Kapitel: „Algérie, l’islamisme contre les intellectuels?“ (Vgl. in diesem Heft)
5 Die „Ethnisierung“ des Konfliktes ist eine der Strategien solcher „eingefleischten Demokraten“, die in den Berbern die Avantgarde der Demokratie sehen: unter ihnen Personen wie Khalida Messaoudi, die mit der Rhetorik des Faschismus und der Résistance jongliert (von ihr stammt der Satz: „Der Hijab, das ist der gelbe Stern der Frau, die erste Etappe ihrer physischen Vernichtung“; Rachid Mimouni dekretiert seinerseits: „Die Frau ist für einen Islamisten wie ein Jude für einen Nazi“; beide Zitate in: Burgat, 210); Said Sadi, der Vorsitzende des RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie), ist bereit – laut eigenen Aussagen – 100 000 Tote in Kauf zu nehmen, um seinen Gesellschaftsentwurf realisiert zu sehen, in: Oliver Fahrni, „Die Tricks der Generäle“, Die Woche, 10. November 1995; Vgl auch S. Mellah, „Algerien, kolonialer Diskurs einst und heute“, Silsila 5/95.
6 Zit. in: W. Herzog, Algerien: Zwischen Demokratie und Gottesstaat, München 1995, 111.
7 Die in der Plattform vorgesehenen Verhandlungen zwischen allen beteiligten Parteien sollen auf der Basis eines „Nationalvertrages“ geschehen. Die notwendigen Voraussetzungen sind u.a.: die Ablehnung von Gewalt; die Unverzichtbarkeit des Mehrparteiensystem; die Aufhebung des Verbotes der FIS; die Freilassung der Gefangenen; die Aufhebung aller Sondergesetze; die Anerkennung der berberischen, arabischen und islamischen Identität; die Einrichtung einer unabhängigen Sonderkommission zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen. Eine Nationalkonferenz soll einberufen werden, die die Übergangsstrukturen und Vorgehensweisen festlegt und schließlich pluralistische Wahlen vorbereitet.
8 Le Monde, 7. März 1995.
9 François Burgat, 171
10 Der Anfang 1995 ausgerufene „Plan Vigile“ erlaubte den französischen Behörden im Namen der „Terrorismusbekämpfung“ 59 000 „illegale“ Personen auszuweisen; das „Livre blanc de la répression“ wurde im September 1995 verboten; dem Vorsitzenden der FFS, Ait-Ahmed, wurde verboten, eine Pressekonferenz abzuhalten; der junge Kelkal wurde als mutmaßlicher Verantwortlicher für die Métro-Attentate von Sicherheitskräften liquidiert.
11 Groupe Islamique Armé wird für die meisten Anschläge verantwortlich gemacht.
12 BBC zur Wahl, 16.11.95.
13 Al-Hayat, 12.12.95.
14 Samuel Schirmbeck, „Islamisten ausgegrenzt“, Frankfurter Rundschau, 19. April 1996.