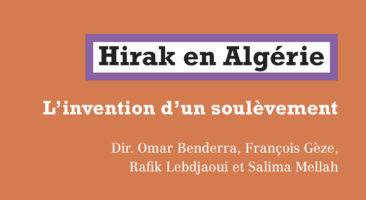Nach zehn Jahre Krieg, neue Hoffnung in Algerien?
Salima Mellah, algeria-watch, Sommer 2001
Der algerische « Frühling »
Der Demokratisierungsprozess in Algerien wurde nach den blutig niedergeschlagenen Unruhen von Oktober 1988 eingeleitet. Der Pluralismus wurde in der Verfassung von 1989 verankert, und ein neues Gesetz regelte die Gründung von Parteien und Vereinen. Dutzende von politischen Formationen, Hunderte von Assoziationen und eine Vielzahl von Zeitungen traten in Erscheinung. Algerien erlebte einen wahrhaftigen Umbruch, der eine Abschaffung des autoritären Einparteiensystems versprach. Diese überwältigende Aufbruchstimmung, die alle Gesellsaftsschichten erfasste, schien selbst das staatlich kontrollierte Fernsehen mit sich zu reißen. Öffentliche Debatten, die unterschiedlichste Meinungen zu Wort kommen ließen, hielten die Zuschauer in Atem. Kommunal- und Parlamentswahlen standen vor der Tür, und jede Strömung versuchte, ihre Kräfte zu mobilisieren.
Die Islamisten, die stärkste Kraft im Land, ergriffen die Gelegenheit, nicht nur die FIS (Islamische Rettungsfront) zu gründen, sondern auch ihre sozialen Tätigkeiten durch legale Strukturen zu offizialisieren. Währenddessen agierte eine große Zahl von republikanischen, liberalen und sozialistischen Gruppen, ohne jedoch ein Bündnis miteinander schließen zu können. Sie bezeichneten sich als « dritte Kraft » gegenüber der Einheitspartei und ihren Satellitenorganisationen und den Islamisten, doch gelang es ihnen nicht, eine Front für die bevorstehenden Wahlen zu bilden. Das grundlegende Hindernis war nicht vorrangig ihre heterogenen Zielsetzungen, sondern ihre Nähe zur Junta. Dies wird sich bald deutlich zeigen.
Im Juni 1990 fanden die ersten pluralistischen Kommunalwahlen statt. An die FIS fielen überraschenderweise über 50 % der Gemeindeverwaltungen. Den politischen Gegnern wurde schlagartig die Stärke und der Einfluss der Islamisten bewusst. Nun wurde versucht, die FIS zu diskreditieren, indem sie als eine Partei der Ausgeschlossenen, autoritär, frauenfeindlich, populistisch, fanatisch usw. dargestellt wurde. Sicherlich gab es Anhänger der FIS, die intolerant und gewalttätig waren, doch die gesamte Partei, weil sie religiösen Grundsätzen folgte für faschistisch zu erklären, entbehrt jeglicher historischen wie politikwissenschaftlichen Grundlage.
Im Juni 1991 rief die FIS zu einem Generalstreik auf, um gegen das Wahlgesetz und die Aufteilung der Wahlbezirke zu protestieren – die die FLN (ehemalige Einheitspartei) begünstigen sollten. Trotz der Verhandlungen mit der Regierung wurde der Streik blutig niedergeschlagen, und die zwei FIS-Führer wurden kurz später inhaftiert. Die Regierung der Reformer zahlte auch den Preis für die Verhandlung, indem sie abgesetzt wurde. Die Repression, die sich in Form von Verhaftungen, Erschießungen, Einrichtung von Internierungslagern und Entlassungen von Streikenden aus den Betrieben niederschlug, wurde von den sogenannten Demokraten nicht verurteilt.
Die Frage, ob diese Episode des Streiks und seine nachhaltigen Folgen von gewissen Machtstrategen beabsichtigt war, um dem reformerischen Kurs der Regierung Einhalt zu gebieten, muss noch offen bleiben. Fest steht, dass die für Juni 1991 vorgesehenen Parlamentswahlen auf Dezember 1991 und Januar 1992 verschoben wurden. Lange Zeit war nicht klar, ob die FIS überhaupt daran teilnehmen würde. Die offiziösen Prognosen lauteten, daß die geschwächte FIS nicht mehr als 30% der Wählerstimmen erhalten würde und die zwei anderen « Blöcke » – Nationalisten der FLN und « Demokraten » – die restlichen zwei Drittel unter sich aufteilen würden. Dieses Kalkül ging nicht auf: Im ersten Wahlgang am 26. Dezember 1991 erhielt die FIS die Mehrheit der Sitze, und es war zu erwarten, daß sie mit dem zweiten Wahlgang die Zweidrittelmehrheit erreichen würde.
Vorbereitungen auf den Putsch
Die « republikanischen » Kräfte erhielten praktisch keine Stimmen, während die FFS (Front der Sozialistischen Kräfte) und die FLN weit hinter der FIS lagen und gleich viele Sitze erlangen. Angesichts des Erdrutschsieges der FIS versammelten sich die Befürworter eines Wahlabbruchs, um diesen vorzubereiten. Das Nationale Komitee zur Rettung Algeriens wurde ins Leben gerufen. Währenddessen versuchte die FFS mit einer großen Demonstration für den zweiten Wahlgang zu mobilisieren. Etwa 40% der Wahlberechtigten hatten ihre Stimme nicht abgegeben, und noch war nicht abzusehen, ob die FIS die absolute Mehrheit der Sitze gewinnen würde. Diese Demonstration brachte Hunderttausende auf die Straße.
Die Militärführung ließ es nicht auf einen zweiten Wahlgang ankommen. Der Staatspräsident wurde de facto abgesetzt, das Parlament aufgelöst und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Der Ausnahmezustand wurde kurz später ausgerufen, und die FIS und alle ihr nahestehenden Vereine und Einrichtungen, verboten. Die flächendeckende Repression gegen die politischen Strukturen und Kader der FIS führte zwangsläufig zur Radikalisierung der Bewegung. Allerdings rechtfertigten die zunehmenden Anschläge von Seiten islamistischer Gruppen nicht, daß die sog. Demokraten, die mit viel Mut die systematische Folter während der Unruhen von Oktober 1988 verurteilt hatten, jetzt nicht nur schwiegen, sondern ein härteres Durchgreifen der Sicherheitskräfte forderten. Der « totale Krieg » wurde ausgerufen und von den Eradicateurs (Ausmerzer) begrüßt. Sie behaupteten, dass ein hartes Durchgreifen der Armee besser sei als ein Sieg der FIS, die das Land in ein Blutbad gestürzt hätte.
Die künstliche Polarisierung
Die vor den Wahlen zugespitzte Polarisierung zwischen sogenannten « Demokraten » und « Fundamentalisten » erlaubte keine nüchterne Einschätzung der dramatischen Lage und erschwerte die Forderung nach einer friedlichen Lösung durch den Dialog zwischen den Kontrahenten. Fürsprecher einer Versöhnung wurden zu objektiven Komplizen des sich immer weiter ausbreitenden Terrorismus deklariert. Die Frage nach den Urhebern des Terrorismus wurde quasi verboten. Diese unnachgiebige Haltung drückte sich auch aus, als die repräsentativen Parteien sich Ende 1994 und Anfang 1995 in Rom trafen und eine Plattform zur Lösung der Krise unter der Ägide der St. Egidio Gemeinschaft erarbeiteten. Sie wurden von Regierungskreisen und sonstigen Dialoggegnern schlichtweg als Verräter bezeichnet und marginalisiert.
Die Repression auf staatlicher Seite und die Gewalt, die von parastaatlichen und islamistischen Gruppierungen ausging, brachte das rege Parteien- und Vereinsleben völlig zum Erliegen. Der Ausnahmezustand, das Anti-Terrorgesetz, die Ausgangssperre, die Straßensperren, Durchkämmungsoperationen, willkürlichen Festnahmen usw. wurden begleitet durch Versammlungsverbote und eine Kontrolle der Presse , die jede Kritik im Keim erstickte. Obwohl die Ermordungen von öffentlichen Persönlichkeiten aller Gesellschaftsschichten nicht aufgeklärt wurden, löste dieser Umstand kaum Empörung aus. Es sei daran erinnert, dass etwa 60 Journalisten getötet wurden. Viele fragten sich im Privatkreis und manche wagten dies öffentlich zu verkünden, ob nicht der algerische Geheimdienst ein Interesse an dem Verschwinden mancher dieser Personen hatte. Doch propagandistisch schickte es sich nicht, diese Zweifel mit der Forderung nach Aufklärung zu verknüpfen.
Eine Fassaden-Demokratie
Nach dem Treffen der Oppositionsparteien in Rom befand sich das Regime in einer Zwickmühle, da seit drei Jahren keine repräsentativen Strukturen das Land regierten. Um sich der Kritik von Außen zu entledigen, war es für die Machthaber notwendig, den Schein einer Demokratie zu simulieren. Noch nie wurden so viele Wahlen inszeniert wie unter der Diktatur.
Während für die meisten gesellschaftspolitischen Gruppen kaum mehr Bewegungsfreiheit bestand, schienen diejenigen, die die militärische Option befürworteten keine Schwierigkeiten zu haben, neue Vereine und Gruppierungen zu gründen, Veranstaltungen abzuhalten und Demonstrationen zu organisieren. Sie wurden als Verkörperung der « zivilen Gesellschaft » Algeriens hochstilisiert, als Widerstandskämpfer gegen den Fundamentalismus in Europa von Hand zu Hand gereicht und genossen die « internationale Solidarität der Demokraten ».
Die zahlreichen Frauengruppen, die vor 1992 aktiv waren, lösten sich im Zuge der allgemeinen Repression auf. Nichtsdestotrotz schienen manche weiterhin für die Rechte der Frauen sich einzusetzen und in diesem Sinne gegen den « Fundamentalismus » zu kämpfen. Eine wichtige Forderung war seit eh und je die Abschaffung oder Veränderung des 1984 verabschiedeten Familiengesetzes. Jahrelang wurde auf die reaktionäre Haltung der Regierung hinsichtlich der Stellung der Frauen hingewiesen und betont, dass sie diesbezüglich die Interessen der Islamisten teilt. Die Frauenrechtlerinnen wurden als mutige Frauen gefeiert, die in Zeiten des Terrors wagten, der Macht und den Terroristen die Stirn zu bieten. Doch als diese Frauen schließlich selbst an der Macht partizipieren konnten, ließen sie ihre einst so vehement vertretenen Forderung nach der Abschaffung des Familiengesetzes fallen.
Vereinigungen der « Opfer des Terrorismus » wurden ins Leben gerufen, doch unter Ausschluss der Familien der Verschwundenen, die kurzerhand als Komplize des Terrorismus bezeichnet wurden. Diese Familien erfahren seit Jahren die Marginalisierung von Seiten des Staates. Als sie 1998 endlich den Mut fassten, sich zu organisieren, und an die Öffentlichkeit gingen, um nach dem Schicksal ihrer verschwundenen Angehörigen zu fragen, hatten sie einen sehr schweren Stand. Sie hatten die Rückendeckung einiger Menschenrechtsaktivisten, die selbst keine Erlaubnis erhalten hatten, einen Büroraum zu mieten. Zwar nahmen sich zwei Parteien ihrer an, doch die trotzkistische Arbeiterpartei lehnt eine Internationalisierung der Frage der Verschwundenen kategorisch ab, obwohl die betroffenen Familien alles daran setzten, der Weltöffentlichkeit ihr Anliegen mitzuteilen. Bis heute ist keine Vereinigung der Angehörigen der Verschwundenen offiziell anerkannt worden, und ihre wöchentlichen Versammlungen werden oft gewaltsam von Sicherheitskräften aufgelöst. Dank der Hartnäckigkeit dieser überwiegend von Frauen bestehenden Gruppen, der wenigen Rechtsanwälte, die sich der Sache angenommen haben, und der internationalen Menschenrechtsorganisationen ist das Drama des Verschwindenlassens, das mindestens 10 000 Menschen betrifft und bis heute weiter anhält, weltweit bekannt geworden.
Die Organisations- und Versammlungsverbote betreffen nicht nur Menschenrechtsgruppen und Opfer der Repression. Die seit 1993 existierende Jugendorganisation RAJ (Rassemblement – Action – Jeunesse), die 1999 den Bremer Solidaritätspreis erhielt, erfährt massive Beeinträchtigungen in ihrer Informations- und Aufklärungsarbeit zu gesellschaftspolitischen Themen wie Armut, Aids, Bildung usw. Dutzende Anfragen für Veranstaltungen wurden nicht genehmigt, und im letzten Jahr hat die Organisation aufgegeben, öffentliche Veranstaltungen abzuhalten. Ähnliche Erfahrungen machen auch die Parteien oder Organisationen, die sich für eine Versöhnung aussprechen. Die FFS (Sozialistische Partei) hat immense Schwierigkeiten, Räumlichkeiten zu mieten, die LADDH (unabhängige Menschenrechtsorganisation) musste bereits angekündigte Konferenzen absagen, weil sie die Räumlichkeiten nicht erhielt usw.
Weder Frieden noch Demokratie
Viele Beobachter vor allem im Ausland hatten gehofft, dass mit der « Nominierungswahl » von Bouteflika im April 1999 und aufgrund seiner Politik der « nationalen Aussöhnung » die Meinungs- und Versammlungsfreiheit wieder eingeführt wird. Dem ist nicht so. Im Juni 2001 wurden die Strafmaße für Diffamierungsdelikte erhöht und im Strafgesetzbuch verankert. Nun steht eine Verschärfung der Verteidigerrechte bevor: Ihre Kanzleien sollen jederzeit von der Polizei durchsucht werden können, ihnen soll verboten werden, Informationen an die Öffentlichkeit weiter zu geben, und sie müssen eine Anwesenheitspflicht bei den Prozessen respektieren.
Die Forderung nach einer internationalen Untersuchungskommission bezüglich der Massaker, die von der Regierung und einen Teil der politischen Klasse strikt abgelehnt wird, ist weiterhin ein Tabuthema. Diejenigen, die wagen, nach den wirklichen Urhebern dieser Verbrechen zu fragen, werden weiterhin beschimpft und beschuldigt, die islamistischen Terroristen reinzuwaschen. Dabei finden bis heute Massaker statt, ohne dass die Täter gefasst werden noch der Öffentlichkeit die Motive für diese Verbrechen klar sind. Die Frage « Wer tötet » hat seit Beginn der Massaker 1995 nicht an Aktualität verloren.
Das politische Leben ist seit dem Machtantritt Bouteflikas noch weiter zurück gedrängt worden. Die AIS, der bewaffnete Arm der FIS, und andere Gruppen haben zwar ein Abkommen mit dem militärischen Geheimdienst abgeschlossen und ihre Waffen niedergelegt doch dürfen sie sich entgegen den offiziellen Versprechungen bislang nicht politisch betätigen. Dies betrifft auch der politische Teil der FIS. Die Bestrebungen eine neue Partei (Wafa) zu gründen, wurden erstickt und ein Teil der laizistischen Opposition (ANR, RCD) beteiligte sich an die Regierungsgeschäfte. Die FFS, die einzig übriggebliebene repräsentative legale Partei wird durch diverse Angriffe und interne Auseinandersetzungen marginalisiert. Selbst die Kreise, die in den vergangenen Jahren immer wieder ihren Protest auf den Straßen kundtun durften, weil sie dem Regime diente, sind in den vergangenen Wochen wiederholt bei Demonstrationen Repressalien ausgesetzt worden.
Aufstände für mehr Partizipation
Angesichts dieser desolaten Lage, in der die Bevölkerung seit Jahren Opfer der polizeilichen und militärischen Willkür ist und keine Partizipationsmöglichkeiten hat, ist im April in der Kabylei ein Aufstand entfacht, der sich wie ein Lauffeuer über mehrere Regionen erstreckte. Die meist jungen Demonstranten ertragen die Demütigungen und Ungerechtigkeiten nicht mehr, die sie in allen Lebensbereichen erleiden müssen und richten ihre Wut gegen alle Staatssymbole und Sicherheitskräfte.
Die seit fast drei Monaten anhaltenden Unruhen haben etwa 100 Tote und Tausende von Verletzten gefordert, und Hunderte wurden gefoltert. Nach mehreren Wochen organisierten sich die Bewohner in Dorfkomitees und stellten sehr konkrete Forderungen an die Regierung: Neben dem Abzug der Gendarmerie verlangen sie u.a. ein Ende der Demütigungen, Straffreiheit für die Demonstranten, die Verurteilung der in Übergriffe verwickelten Sicherheitskräfte, Anerkennung der Berber-Kultur und ernstzunehmende ökonomische und soziale Programme. Sie betonen ihre Unabhängigkeit von den politischen Parteien, doch Vertreter der in der Kabylei ansässigen Parteien, FFS und RCD (liberale, republikanische Partei), sind durchaus in den Komitees präsent.
Diese basisdemokratische Organisierung, die in der Kabylei auf eine Tradition beruht, beginnt auch in anderen Regionen Fuß zu fassen. Selbst in Algier entstehen Viertelkomitees, die ähnliche Forderungen vorbringen. Nachdem die von den Dorfkomitees organisierte Demonstration in Algier am 14. Juni, an der etwa eine Million Menschen teilgenommen hat, blutig niedergeschlagen wurde, hat die Regierung jede Demonstration in der Hauptstadt verboten. Dies betraf auch die zum Jahrestag der Unabhängigkeit am 5. Juli geplante Demonstration der Delegierten der Dorfkomitees. Nichtsdestotrotz begaben sich an die 7000 Delegierte aus verschiedenen Regionen des Landes nach Algier. Sie wurden auf den Zufahrtsstraßen durch Polizeisperren daran gehindert, bis nach Algier zu kommen. Sie kehrten in ihre Dörfer und Städte zurück, entschlossen, ihren Protest weiter zu führen.
Noch lässt sich nicht sagen, wohin diese Entwicklung führen wird. Es bleibt zu hoffen, dass diese Protestbewegung gegenüber den Manipulationen und Versuchen der Vereinnahmung oder Spaltung von Seiten des Staates und des Geheimdienstes standhalten wird. Ob sie das Regime zwingen kann, eine Demokratisierung zuzulassen, die alle Kräfte mit einbezieht, hängt auch von der Haltung der ausländischen Partner ab. Anfang Juli haben 24 Europaabgeordnete einen Appell veröffentlicht, der eine euro-algerische Untersuchung der jüngsten Ereignisse und die Aussetzung der Verhandlungen bezüglich des Assoziationsvertrages bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse der Untersuchung fordert. Die Forderung nach einer Untersuchungskommission sollte sich durchaus auf die letzten 10 Jahre beziehen, denn ohne dass alle Verantwortlichen für die gesamte Tragödie ausgemacht werden, wird keine wirkliche Versöhnung stattfinden können.